"In Deutschland gibt es für unbescholtene Personen das Unschuldsprinzip. Herr Herda stellt die Lehrerin an den Pranger, weil es offensichtlich die Eltern so für richtig halten", attackiert die Leserin aus Wernberg-Köblitz den Autor Jürgen Herda. Dieser hatte in einem Kommentar unter anderem geschrieben: "Es ist die Aufgabe der Medien, Vorwürfe von öffentlichem Interesse zu hinterfragen. Erstklässler, die reihenweise psychosomatisch erkranken, sind allemal von öffentlichem Interesse. Die Verantwortlichen hatten Monate Zeit, sich mit den Vorwürfen der Eltern intern auseinanderzusetzen. Das haben sie versäumt und damit das Vertrauen der Eltern verspielt. Deshalb müssen sie sich jetzt öffentlich damit befassen."
Auch diese Äußerung missfiel der Leserin: "Herr Herda überhöht mit dieser Aussage meiner Meinung nach seine Stellung als Journalist gewaltig. Er spielt sich auf, als sei er in einem Gerichtsverfahren Anwalt der Eltern und Richter (...) in einer Person."
Autor gibt Einblick
So weit einige wenige der zahlreichen Vorhaltungen, die die Frau dem Autor machte. Herda hatte sich in drei Artikeln ("Zu dumm für die erste Klasse?", "Keine schlechte Pädagogin?", "Katastrophale Kommunikation") mit den bekannt gewordenen Problemen an der Wackersdorfer Grundschule befasst. Im Folgenden äußert sich Jürgen Herda zu den Vorwürfen, gibt Einblick in seine Recherchen und bezieht Position. Transparenz, die an dieser Stelle notwendig erscheint.
"Es ist keine Überhebung meinerseits oder der Presse, bei entsprechender Informationslage zu recherchieren, wenn ein ,öffentliches Interesse' vorliegt", betont Herda. Wenn an einer Grundschule acht Eltern (-paare) glaubhaft darlegen, dass eine Lehrkraft durch unpädagogisches Verhalten mit dazu beigetragen habe, dass Kinder einer ersten Klasse (!) zumindest die Lust an der Schule verloren haben, zumeist aber Angst vor dieser haben, und zwar in einem Ausmaß, dass sie psychosomatische Erkrankungen erlitten, dann sei das selbstverständlich von öffentlichem Interesse.
Auch deshalb, weil die Eltern über Monate hinweg versucht hätten, das Problem mit der Lehrkraft, dem Rektor oder dem Schulamt intern zu lösen - ohne jeden Erfolg. Es habe zudem Anzeichen dafür gegeben, dass eine solche Klärung mit Rücksicht auf den Ruf der Schule nicht erwünscht sei.
Herda erläutert weiter: "Als Redakteur bekommt man natürlich auch konkrete Handlungsaufträge. Wenn, wie in diesem Fall, bereits die BILD-Zeitung und die SZ berichtet hatten, die Vorwürfe also bereits öffentlich waren, ging es auch nicht mehr um die Abwägung, ob man zu welchem Zeitpunkt berichtet, sondern wie. Die Herangehensweise ist wie aus dem Handbuch des Journalismus: Befragung aller Seiten. Und natürlich haben öffentliche Stellen eine Informationspflicht den Medien gegenüber. Dabei ist es auch mitnichten naturgegeben, dass sich Betroffene gar nicht zu Vorwürfen äußern - es gibt ein breites Feld möglicher Handlungsoptionen."
Gespräch abgelehnt
Herda verweist darauf, dass er dem Rektor vorgeschlagen hat, ein gemeinsames Gespräch mit der Lehrkraft zu führen. "Man kann so etwas als Hintergrundgespräch definieren, bei dem man zumindest die Möglichkeit hat, sich ein Urteil zu bilden." Herda stieß auf Ablehnung und sagt dazu: "Die Art und Weise, wie reagiert wurde, wurde im Übrigen auch von höheren Stellen - vorsichtig formuliert - als unglücklich bezeichnet." Wenn die Vorwürfe haltlos sind, was hindert Lehrkraft und Rektor an einem Dementi?, fragt sich Herda. "Verwundert" zeigt er sich darüber, dass die Leserin, obwohl sie offensichtlich mit keiner Seite gesprochen hat, ein Urteil über die betroffenen Eltern und Kinder fällt.
Herda hat der Frau dazu geschrieben: "Wie kommen Sie darauf, dass die Kinder schlechte schulische Leistungen erbrachten? Gerade der Junge von Frau Kehrer galt bis zu dem Moment, als es erste Beschwerden gab, als intelligenter Musterschüler. Andere Schüler haben, nachdem sie andere Lehrer bekamen, wieder Freude an der Schule. Was für eine Verschwörung wollen Sie eigentlich acht Elternpaaren unterstellen, die teils drastische Unterrichtsmethoden beschreiben, die auf Nachfrage bei entsprechenden Stellen nirgends als tolerabel bezeichnet wurden? Es gibt auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass elterlicher Ehrgeiz Triebfeder der Beschwerden sein könnte - schließlich geht es hier nicht um den Übertritt ins Gymnasium, sondern um eine erste Klasse, nach der es gerade mal eine schriftliche Bewertung der Leistung gibt."
"Völlig aus der Luft gegriffen" ist für Herda der Vorwurf der Leserin, er spiele sich als "Anwalt der Eltern und Richter" auf. Darauf entgegnet er: "Richtig ist, dass ich als Chronist ihrer Aussagen fungiere, die ich nach bestem Wissen und Gewissen auf ihre Plausibilität hin geprüft habe. Dazu gab es eine Reihe von Hintergrundgesprächen, um etwa die Glaubwürdigkeit der Eltern zu hinterfragen. Dazu dient aber auch die Einschätzung des Weidener Nervenarztes, um abzuklären, ob die von den Eltern dargestellten Situationen tatsächlich den Rahmen normaler pädagogischer Methoden überschreiten - auch hier wieder unter dem Tatsachenvorbehalt."
Keine Vorverurteilung
Stichwort Unschuldsvermutung. Hierzu hält Herda fest: "Ergänzend zur Darstellung der Eltern beschreiben die offiziellen Stellen den Verlauf der Prüfung. Damit steht selbstverständlich auch die Möglichkeit im Raum, dass die Prüfer zu einem anderen Ergebnis kommen. Ich habe sogar die einzige Stimme, die sich auf Facebook aus eigener Erfahrung pro Lehrerin äußerte, zitiert, damit auch positive Eindrücke nicht unter den Tisch fallen." Die Lehrkraft werde nicht namentlich benannt. Also gebe es auch in dieser Hinsicht keine persönliche Vorverurteilung.
Kein pauschales Urteil
Zusammenfassend erklärt Herda: "Es geht in diesem Fall - wie bei vielen anderen Konflikten auch - um eine nicht einfache Güterabwägung zwischen dem Interesse der Schule, der Lehrkräfte, Eltern und Kinder - aber auch der Gesellschaft, die die Anforderung an die von ihr finanzierten Einrichtungen stellen darf, das Potenzial der Schüler optimal zu erschließen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, ist das hier ,suboptimal' geschehen. Nach meinen und den persönlichen Erfahrungen meiner Kollegen sind die allermeisten Kinder in der ersten Klasse neugierig, wissbegierig und haben einen Heidenrespekt vor der Lehrkraft. Die Freude am Wissenserwerb zu fördern und nicht zu zerstören, ist Aufgabe der Pädagogen."
Dass in diesem Artikel kein pauschales Urteil über Lehrer gefällt wurde, sehe man schon an den positiven Einlassungen des Weidener Nervenarztes Dr. Franz Rechl.
Der Kollege hat korrekt gearbeitet
Eines vorweg: Die Artikel über eine angeblich mobbende Lehrerin sind aus meiner Sicht nicht zu beanstanden. Es handelt sich hier um klassische Verdachtsberichterstattung. Davon spricht man, wenn über einen Sachverhalt berichtet wird, dessen Wahrheit nicht erwiesen ist. Natürlich besteht „die Gefahr, dass es zu einer erheblichen Rufschädigung kommt, weil der Betroffene in der Öffentlichkeit bereits während des Verfahrens als Täter angesehen wird“, wie auf Wikipedia nachzulesen ist, wo es aber auch heißt: „Allerdings besitzt die Presse die Funktion, den öffentlichen Prozess der Meinungsbildung durch Berichterstattung anzuregen und zu fördern. Um diesen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, muss die Presse auch bei zweifelhafter Tatsachengrundlage die Möglichkeit besitzen, über einen Sachverhalt zu berichten. Dieser Konflikt zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und der Funktion der Presse wird durch die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Verdachtsberichterstattung aufgelöst.“
Bereits 1999 gab es eine Leitentscheidung des Bundesgerichtshofs zur Verdachtsberichterstattung. Laut BGH dürfen „die Anforderungen an die pressemäßige Sorgfalt und die Wahrheitspflicht nicht überspannt und insbesondere nicht so bemessen werden, dass darunter die Funktion der Meinungsfreiheit leidet. Straftaten gehören nämlich zum Zeitgeschehen, dessen Vermittlung zu den Aufgaben der Medien gehört. Dürfte die Presse, falls der Ruf einer Person gefährdet ist, nur solche Informationen verbreiten, deren Wahrheit im Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits mit Sicherheit feststeht, so könnte sie ihre durch Art. 5 I GG verfassungsrechtlich gewährleisteten Aufgaben bei der öffentlichen Meinungsbildung nicht durchweg erfüllen, wobei auch zu beachten ist, dass ihre ohnehin begrenzten Mittel zur Ermittlung der Wahrheit durch den Zwang zu aktueller Berichterstattung verkürzt sind. Deshalb verdienen im Rahmen der gebotenen Abwägung zwischen dem Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit regelmäßig die aktuelle Berichterstattung und mithin das Informationsinteresse jedenfalls dann den Vorrang, wenn die oben dargestellten Sorgfaltsanforderungen eingehalten sind. (BGH NJW 2000, 1036, 1037).“
Bei einer zulässigen Verdachtsberichterstattung sind die Anforderungen in Bezug auf die journalistische Sorgfaltspflicht hoch. Die Presserechts-Experten der Initiative Tageszeitung verdeutlichen dies mit sechs Punkten:
1. Der Verdacht muss von öffentlichem Interesse sein.
2. Es muss ein Minimum an Beweistatsachen geben, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen. Die Aussage eines Informanten, die ein bloßes Anschwärzen sein kann, reicht hier nicht. Auch das Vorliegen einer womöglichen Strafanzeige genügt nicht, denn diese kann ebenso aus der Luft gegriffen sein. Der Verdacht muss zusätzlich durch objektive, belegbare Indizien und Tatsachen begründet sein.
3. Der Betroffene muss zu den Vorwürfen gehört worden sein, und seine Stellungnahme muss sich in ihren wichtigsten Punkten im Bericht wiederfinden. Ist der Beschuldigte nicht zu sprechen, beispielsweise weil er sich durch Untertauchen entzieht, genügt es, wenn der Journalist nachweisen kann, dass er sich rechtzeitig und ernsthaft um eine Stellungnahme bemüht hat.
4. Alle erreichbaren Quellen müssen ausgeschöpft werden.
5. Alle entlastenden Tatsachen müssen mitgeteilt werden.
6. Der Bericht muss den Vorwurf mit journalistischer Distanz wiedergeben, um jegliche Vorverurteilung zu vermeiden. Der Text muss deutlich zwischen Verdacht und bewiesener Schuld unterscheiden.







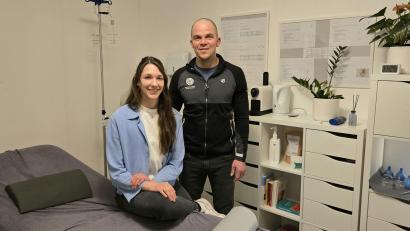






Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.