Einige tote Vögel wurden in den vergangenen Wochen im Kreis Tirschenreuth gefunden. Mit den heißen Temperaturen hänge das Vogelsterben nicht zusammen, sagt Bernhard Moos. Vögel könnten die Hitze ohne größere Probleme ertragen - genauso wie kalte. "Ihr Federkleid isoliert gut", weiß der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach. Ihre Körpertemperatur liegt außerdem bei etwa 43 Grad und der Stoffwechsel der Vögel benötige nicht viel Wasser, weshalb die Tiere auch nicht so schnell verdursten würden, erläutert der Diplom-Biologe.
Moos tippt eher darauf, dass Tiere gegen Fensterscheiben geflogen sind oder Jungtiere, die sich beim Futtersuchen noch etwas ungeschickt anstellten, verhungert sind. "Durch die Wetterlage sind die Vögel nicht gefährdet." Dennoch sei es gut, "wenn man im Garten Gelegenheit bietet, wo die Vögel trinken können", sagt Moos.
Steine in der Vogeltränke
Am besten soll die Tränke frei und erhöht stehen, erläutert Zeno Bäumler, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Schwandorf. Dann fühlen sich die Vögel sicher, eine Katze kann sich daneben nicht verstecken und auf Beute lauern. Außerdem sollten Tierfreunde das Wasser täglich wechseln, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Die Schale sollte flach sein und eine raue Oberfläche haben - oder man gibt ein paar Kieselsteine hinein, damit die Vögel beim Baden sich gut festhalten können und nicht ausrutschen.
Der trockene und harte Boden sei ein "Problem für Vögel, die Insekten fressen", findet dagegen Bäumler. Vor allem für Amseln, die sich gerade um die zweite oder dritte Brut kümmern. Sie suchen für ihren Nachwuchs vor allem weiche Insekten wie Würmer oder Schnecken, die auch Feuchtigkeit liefern - was momentan schwierig sein dürfte. "Mehlwürmer wären eine gute Alternative", findet der gelernte Tierwirtschaftsmeister aus Wernberg-Köblitz. Wer ein Amselnest in seinem Garten hat, könnte die Vogelfamilie bei der Futtersuche unterstützen. Die Würmer gibt es im Zoofachhandel zu kaufen. Ein paar davon in einem Schälchen mit glattem Rand in den Garten stellen. Aber: "Getrocknete Mehlwürmer sind nicht optimal, weil die Feuchtigkeit fehlt", sagt Bäumler.
Etwas anderer Meinung ist sein Kollege Moos: Nur wenig Vögel seien abhängig von Regenwürmern. Amseln etwa suchen sich anderes Getier zum Fressen wie Spinnen oder Kellerasseln. Das finden sie auch im Garten: "Hecken pflanzen und das Laub darunter liegen lassen", rät Bäumler.
"Dezent füttern"
Zur Futtersuche gebe es bei Vogelschützern grundsätzlich zwei Strömungen: Die einen sagen, man solle die Tiere das ganze Jahr über füttern, die anderen meinen, das sei nur im Winter nötig. "Ich bewege mich dazwischen", gesteht Moos. Seiner Meinung nach können Gartenbesitzer auch im Sommer einen Meisenknödel aufhängen oder etwas Körner ausstreuen - aber immer "dezent füttern". Doch wenn ein Tierliebhaber zu viel Nahrung anbietet und dann plötzlich damit aufhört, "kennen sich die Vögel nicht mehr aus". Ein weiteres Problem: Finden sich durch reichlich Futter viel mehr Tiere im Garten ein als die Fläche eigentlich verträgt, fressen die Vögel auch alles andere vermehrt, zum Beispiel Insekten, erläutert Moos.
Auch wenn der heiße Sommer 2019 kaum ein Problem für die Vögel darstelle - den Tieren geht es insgesamt nicht mehr so gut wie noch vor Jahrzehnten. Nach der Brutzeit könnten zwar viele mit pflanzlichem Futter auskommen: Blüten, Früchte oder Getreide, zählt der Amberg-Sulzbacher Kreisgruppenvorsitzende auf. Allerdings sei es heutzutage üblich, dass Bauern ihre Äcker nach der Ernte recht schnell umbrechen, um Unkraut zu vermeiden. Vor etwa 20 Jahren lagen die Felder noch längere Zeit brach, erinnert sich Moos. Von den übriggebliebenen Pflanzenteilen haben sich viele Tiere ernährt.
Auch gibt es nicht mehr so viele Bauernhöfe, Feldraine oder Brachflächen. "Jeder Kuhstall war eine Brutstätte für Fliegen", erläutert Moos. Vögel fühlten sich dort wohl. Seit 30 bis 40 Jahren verwandle sich die Natur, sodass weniger Nahrungsmittel zur Verfügung stehen und einige Vogelarten zurückgehen - wie die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019. Auf der LBV-Internetseite heißt es: "Ein Drittel der Feldlerchen sind in den vergangenen 25 Jahren verschwunden."






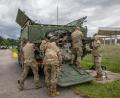







Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.