Die Forderung, alle Schüler in Deutschland sollten verpflichtet werden, die Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrationslagern zu besuchen, klingt zunächst vernünftig und unterstützenswert. Es kann und muss Jugendlichen zugemutet werden, sich mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, sich dem Unbegreifbaren zu nähern.
Aber ist das der richtige Weg? Bei Instagram sind Schnappschüsse zu sehen, die einen an dieser Idee zweifeln lassen: Teenager schneiden Grimassen vor den Gaskammern in Auschwitz, machen Selfies mit Siegergesten vor der Tor-Aufschrift "Arbeit macht frei", posieren auf den Bahngleisen, auf denen Menschen in den Tod geschickt wurden. Man kann sich vorstellen, welchen Dressurakt Lehrerinnen und Lehrer bei solchen Ausflügen manchmal vollführen müssen, damit die Sache nicht noch peinlicher wird. Die Schlussfolgerung: Wer keinen Anstand gelernt hat, der hat in Auschwitz, Dachau oder Flossenbürg nichts verloren. Und das gilt auch für Erwachsene.
Es bringt nichts, schon gar nicht Einsicht und Erkenntnis, wenn man Schülerinnen und Schüler zwingt, an Orte zu fahren, deren Bedeutung sie nicht begreifen oder nicht begreifen wollen. Letztlich muss die Entscheidung ohnehin im Ermessen der Lehrkräfte liegen. Im Unterricht können sie versuchen, die Köpfe und Herzen der Jugendlichen für das Thema zu öffnen: mit Literatur, Berichten von Zeitzeugen oder auch Spielfilmen. Nur bei denjenigen, die dabei Empathie und Interesse zeigen, ergibt der Besuch einer Gedenkstätte auch wirklich Sinn.

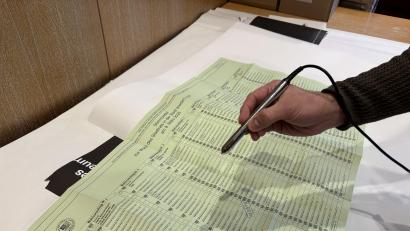












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.