Der Wirtschaftsethiker Dr. Philippe Merz von der Thales-Akademie für Wirtschaft und Philosophie in Freiburg referierte bei der 15. offenen Tagung der Vereinigung der Medien-Ombudsleute, kurz VDMO. Gastgeber war die Badische Zeitung in Freiburg.
Merz schickte seinen Ausführungen unter anderem die Feststellung voraus, dass das Informationsmonopol und die Deutungshoheit der klassischen Medien der Vergangenheit angehörten. Das bekommen Journalisten nahezu täglich zu spüren, und das führt Merz zufolge zu den verschiedensten Reaktionen: Zum einen sei ein Aufbruch zu erkennen, zum anderen aber auch Verunsicherung und Abwehr spür- und erlebbar. Mitunter zeige sich gar Überheblichkeit.
Was ist eigentlich Medienethik? Merz definierte sie so: Sie reflektiere die Bedingungen, die Qualität und die Ausrichtung medialer Handlungen - insbesondere die moralische Verantwortung von Journalisten und Medienunternehmen für die Voraussetzungen und Folgen ihrer Berichterstattung. Merz nannte drei Dynamiken, in die die Medienethik eingebettet sei:
- Die Ökonomisierung
Zeitungen und Zeitschriften bewegten sich in einem harten Wettbewerbsumfeld. In den Redaktionen herrsche Spardruck. Bei den Online-Medien gebe es einen Anzeigen-fixierten Klick-Journalismus. Hinzu kämen Marktkonzentrationen im Hintergrund. Merz sprach von einem schleichenden Wandel im journalistischen Selbstverständnis: Der Journalist agiere nicht mehr als Berichterstatter über die öffentlichen Belange im Dienst der Bürger, sondern als Dienstleister des Kundeninteresses. Das sei ein Problem und gefährlich.
- Die Beschleunigung
Die Grundlogik laut Merz: Der Schnellste gewinnt, nicht derjenige, der am besten recherchiert hat. Gleichzeitig passiere Folgendes: Die Sachverhalte würden immer komplexer und schnelllebiger. Die Entscheidungen würden seltener von Einzelakteuren "gemacht", sie seien das Resultat vielschichtiger Abstimmungsprozesse, Gesetze oder Unternehmensstrategien. Öffentliche Debatten seien durch eine verwirrende Vielstimmigkeit gekennzeichnet, Experten träfen auf "spontane Meinungsäußerer". "Wer kann noch entscheiden, wer Recht hat?", fragt sich wohl nicht nur Merz.
Das Ergebnis eins für Merz daraus: Der Veröffentlichungsdruck verringere Zeit und Muße für eine gesicherte und eigenständige Urteilsbildung vor der Veröffentlichung. Merz: "Wenn's schlecht läuft, sinkt die Qualität der Berichterstattung und damit das Vertrauen in die Medien." Ergebnis zwei: Die Neigung zur reißerischen Schlagzeile wachse.
- Die Individualisierung
Mediale Gemeinschaftserlebnisse, so sagt Merz, seien ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, sie fänden nur noch bei Live-Ereignissen statt. Individualisierte Algorithmen steuerten den Konsum. Eine daraus resultierende Gefahr seien Echokammern. Kommunikationswissenschaftler verstehen darunter das Phänomen, dass viele Menschen in den sozialen Netzwerken dazu neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und sich dabei gegenseitig in der eigenen Position zu verstärken.
Eine weitere Gefahr seien Filterblasen. Die Filter- oder Informationsblase ist ein Begriff der Medienwissenschaft, der vom Internet-Aktivisten Eli Pariser in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2011 verwendet wird. Laut Pariser, so kann man auf Wikipedia nachlesen, entsteht die Filterblase, weil Webseiten versuchen, algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte - dies basierend auf den verfügbaren Infos über diesen Benutzer, beispielsweise seinen Standort, seine Suchhistorie und sein Klickverhalten. Daraus resultiere "eine Isolation gegenüber Informationen, die nicht dem Standpunkt des Benutzers entsprechen". Merz erwähnte außerdem die "fünfte Gewalt", die "sich ad hoc konstituierende Individualmasse".
Für die Zukunft wünscht sich Merz eine "neue Haltung zu den ideellen und ökonomischen Zielen von Qualitätsjournalismus". Die Grundfrage der Medienethik ist für ihn ein "ethisch verantwortungsvoller und zugleich von zahlungsbereiten Bürgern getragener Journalismus im Dienst einer stabilen Demokratie und liberalen Gesellschaft". In diesem Zusammenhang zeigte Merz sechs Lösungswege auf:
1. Korridore der Entschleunigung finden für die Überprüfung von Informationen, eigenständige Urteilsbildung und differenzierte Sprache.
2. Mehr inhaltliche Expertise entwickeln: Raum für Lektüre, Reflexion, Konferenzen, Austausch mit Experten und konträren Meinungen.
3. Nachricht und Kommentar transparenter und konsequenter trennen.
4. Absage an die Illusion der Unparteilichkeit.
5. Kultur der Ausgewogenheit und Nicht-Zuspitzung pflegen.
6. Fehlerkultur und Transparenz vorleben: Selbstkritik immer vor Fremdkritik; Funktionsbedingungen des Journalismus erklären.
Merz zitierte am Ende seines Vortrags den Philosophen Hans-Georg Gadamer mit Worten, die sich Journalisten merken sollten: "Der Andere könnte Recht haben."
Die Vereinigung der Medien-Ombudsleute
Die Vereinigung der Medien-Ombudsleute (www.vdmo.de), jetzt ein eingetragener Verein, hat 20 „persönliche“ Mitglieder (Stand Ende März), dazu bestehen mittlerweile drei Verlagsmitgliedschaften. Dem VDMO gehören auch Oberpfalz-Medien und deren Leseranwalt Jürgen Kandziora an. Die in der Vereinigung zusammengeschlossenen Leseranwälte, Ombudsmänner, Leserbotschafter und Leserredakteure wirken an der Schnittstelle zwischen Lesern und Redaktion nach außen und nach innen.






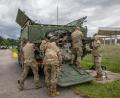







Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.