"Was ist bloß mit dem Journalismus los?" Diese Frage stellte sich der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Siegfried Weischenberg beim Herbstforum der Initiative Qualität (IQ) im Deutschlandradio in Berlin. Weischenberg nahm eine vergleichende Standortbestimmung vor.
Das Misstrauen gegenüber den Medien und ihrem Journalismus sei groß - und dies übrigens, wie Langzeitstudien zur Medienbewertung zeigten, schon seit vielen Jahren. Es beruhe oft auf Erfahrungen im Kleinen, verstärke sich, wenn man selbst betroffen ist, und werde bei manchen Leuten zur Pauschalkritik, auf die in Deutschland seit einigen Jahren das Etikett "Lügenpresse" geklebt wird. Die Kritik an Medien und Journalismus komme seit einiger Zeit in zwei modernen Varianten daher: als pauschale Verdammung von Journalisten durch scheinbar "normale" Bürger und als sensible Selbstbezich- tigung durch bekümmerte Berufspraktiker.
Weniger Journalisten
Weischenberg listete "einige zentrale Befunde" auf. Die Zahl der Hauptberuflichen, die vom Journalismus leben, sei inzwischen von 54 000 auf 41 000 geschrumpft. In Deutschland kämen auf 100 000 Einwohner rund 50 Journalisten, in den USA schätzungsweise weniger als 30. In Österreich seien es 87, in der Schweiz sogar 129 - und in der Türkei 8. Der Frauenanteil im deutschen Journalismus sei hingegen gestiegen: von 33 auf rund 40 Prozent. Nach oben bewegt habe sich auch das Durchschnittsalter: von 37 Jahren (1993) über 41 (2005) auf inzwischen rund 46 Jahre (2015). "Das heißt: Der Journalismus hat ein Nachwuchsproblem - in Deutschland wie auch in den USA", stellte der Referent fest.
Zu weit weg vom Publikum?
82 Prozent könnten inzwischen ein abgeschlossenes Studium vorweisen, nur 2 Prozent seien ohne Abitur. 1993 habe die Zahl noch bei 65 Prozent gelegen. In den 1970er Jahren sei eine "Professionalisierung durch Wissenschaft" gefordert worden, weil die Journalisten zu wenig Kompetenz besäßen. Inzwischen werde diese formale Kompetenz eher negativ gewendet: als Beleg dafür, dass sich die Journalisten viel zu sehr vom Durchschnitt der Bevölkerung unterschieden - zumal die meisten von ihnen (rund zwei Drittel) ohnehin aus der bürgerlichen Mittelschicht stammten. Nur eine kleine Minderheit komme aus dem Arbeitermilieu.
Es gebe damit zu wenig Journalisten aus unteren sozialen Schichten, wohl auch zu wenig mit Migrationshintergrund - und nach wie vor zu wenig Frauen an den Schalthebeln von Medien. Journalisten seien - in Deutschland wie in anderen vergleichbaren Ländern - in ihrer sozialen Zusammensetzung also alles andere als ein Spiegel der Bevölkerung, so wenig übrigens wie Ärzte, Anwälte oder Wissenschaftler. "Deshalb hätten sie, so lautet der daraus abgeleitete Vorwurf, die wirklich wichtigen Themen längst aus dem Blick verloren", erläuterte Weischenberg.
Eine Studie (2014/15) von Münchener Kommunikationswissenschaftlern habe die politischen Einstellungen auf einer Zehner-Skala von links bis rechts erfasst. Ergebnis: Die Journalisten positionierten sich nach wie vor links von der Mitte (Mittelwert: 3,96). Weischenberg dazu: "Eine solche Selbstauskunft der deutschen Journalisten ist natürlich Wasser auf die Mühlen all jener, die den Journalisten grundsätzlich absprechen, dass ihre Berichterstattung ideologisch in der Nähe der Mehrheit der Bevölkerung angesiedelt sei - wobei ein recht großer Teil dieser Bevölkerung ja inzwischen den Journalisten sozusagen ins grüne Lager gefolgt ist."
Der Gesellschaft, meinte Weischenberg, wäre mit einem " keimfreien Journalismus" nicht gedient. Eine "gute Sache" sei der Kampf für eine funktionierende Demokratie und für gleiche Chancen, seien der Klimaschutz und der Kampf gegen Rassismus und Extremismus. Diesen "guten Sachen" dürften, ja müssten sich Journalisten widmen. Gewiss stets nach allen Regeln der Kunst, die sich im Journalismus bewährt haben. Ausgewogenheit - dieses Postulat bewege ja die Kritiker am meisten - könne da nicht immer oberstes Gebot sein. Dazu habe der einst sehr bekannte TV-Reporter Dagobert Lindlau Folgendes geschrieben - und damit sei wirklich alles gesagt: "Ich warte auf den Tag, an dem wir der Ausgewogenheit zuliebe bei einem Bericht über die Hitlerschen KZs einen alten Nazi (oder: inzwischen einen 'neuen Nazi', füge ich hinzu) vor die Kamera holen müssen, der dann feststellt, die Konzentrationslager hätten schließlich auch ihr Gutes gehabt." Es gebe, mit den Worten des berühmten amerikanischen Reporters Ed Murrow, eben "Dinge, die haben nur eine Seite".
Transparent sein
Was die Zukunft des Journalismus anbelangt, nannte Weischenberg zwei zentrale Stichworte: Diversität und Transparenz. Ein Teil der Medien bemühe sich inzwischen durchaus, seinem Publikum nahezubringen, wie die Berichterstattung zustande kommt, welche Gedanken man sich in den Redaktionen macht und wie schwierig und durchaus zufällig oft Selektions- und Präsentations-Entscheidungen ausfallen. Die Debatte über die Frage, ob man die Herkunft von (potenziellen) Straftätern nennen soll, sei nur eines von zahlreichen Beispielen.











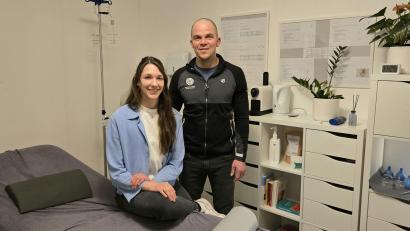


Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.