Stellt man Siri die Sinn-Frage, dann antwortet sie: "Leben: Das, was Lebewesen ausmacht und sie von Objekten unterscheidet. Ich denke, das gilt auch für mich." Olimpia dagegen bringt es mit einem Wort auf den Punkt: "42". Sinn macht diese Antwort nicht, wie so manches, was Nathanael in seinem Dasein zwischen Wirklichkeit und Wahn erlebt. Für die Idee, die hölzerne Puppe aus E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" mit digitaler Intelligenz auszustatten, gab es bei der Premiere im Nürnberger Staatstheater langen Beifall - mehr als 42 Sekunden.
In der Fassung von Clara Weyde und Brigitte Ostermann wird das Ende schon vorweggenommen. Auf einer großen Leinwand erscheint Nathanael mit Engelsflügeln. Mit verzerrter Fratze rennt er auf das Publikum zu, laut rufend "Ich kann fliegen". Den Absturz übernimmt eine lebensgroße Stoffpuppe, die mit einem satten "Plopp" auf die Bühne klatscht. Weiter geht es dann in einer imaginären Trauerhalle, wo dunkle Wesen, mit monotonem Kopfnicken, einer Beerdigungsfeier folgen. Der Sarg ist aufgebaut, eine Trauerrednerin spricht unverständliche Sätze - man ahnt es: Hier übernimmt die Fantasie die Hauptrolle und spielt mit den Zuschauern ein böses Spiel.
E.T.A. Hoffmanns Novelle, 1816 veröffentlicht, übte damals Kritik an der aufklärerischen Gesellschaft und ihrem Vernunftglauben, indem das Wundersame und Unerklärliche in den Mittelpunkt gerückt wurde. Was ist Fake, was ist Wahrheit, diese Befragung der Idee absoluter Wahrheiten nimmt die Nürnberger Inszenierung geschickt auf.
Realitäten verschieben sich, Parallelwelten entstehen (durch ein tolles Doppel-Bühnenbild von David Hohmann), Nathanaels Trauma vom Tod seines Vaters und der Versuch es zu bewältigen, die Flucht in digitale Räume, das alles wird stimmig und eindringlich in Szene gesetzt.
Künstliche Intelligenz als Herausforderung und Verführungskraft unserer modernen Welt? Pauline Kästner als Robotermensch und Maximilian Pulst als getriebener Nathanael verkörpern diesen Gedanken mit exzellentem und eindringlichem Rollenspiel. Obwohl er davor gewarnt wird, "wenn Du Olimpia liebst, dann liebst du ein Programm", kommt der junge Mann nicht von ihr los. Digitale Abhängigkeit, gepaart mit Naivität und Sehnsucht nach Liebe, dieses Thema wird hier durchbuchstabiert.
Hoffmanns Ideen kommen dennoch nicht zu kurz. Das alchemistische Experiment, bei dem Nathanaels Vater angeblich zu Tode kam, wird zum Schluss zum brennenden Ofen, in den sämtliche Protagonisten im Gleichschritt hineinmarschieren. Allerdings entsteht hier das vernichtende Feuer durch einen Programmierfehler - eine bildstarke Inszenierung mit Anregungen und Gedanken, die aktuell sind und nachwirken.

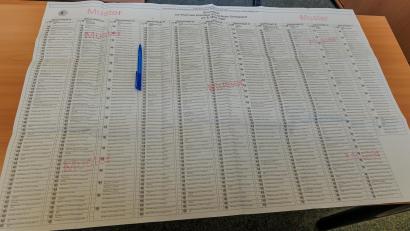












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.