Seit Jahrzehnten schon pflegt Peter Handke die Eigenart, jedes seiner Bücher auf dieselbe Art und Weise abzuschließen. Hinter das eigentliche Ende der Geschichte setzt er noch einen die Zeit und den Ort der Niederschrift nennenden Nachtrag. So auch im neuen, soeben erschienenen Buch "Das zweite Schwert": "April-Mai 2019, Ile-de-France/Picardie".
Das ist dieses Mal deshalb so bedeutsam, weil es vor einer fatalen Fehlinterpretation bewahrt. Wäre sie nicht schon vorher geschrieben worden, könnte man die 170-seitige Erzählung unter anderem als einen nur leicht verbrämten Kommentar auf jene Geschehnisse lesen, die im letzten Herbst mächtig Wellen schlugen. Zur Erinnerung: Peter Handke erhielt im Oktober den Literaturnobelpreis zugesprochen. Es dauerte nur wenige Tage - hielt dann aber monatelang an -, dass man ihm seine Äußerungen zum Jugoslawischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre, die er in Reiseberichten, aber auch in Interviews gemacht hatte, vehement vorhielt und vorwarf.
Das gipfelte in ebenso infamen wie haltlosen Vorwürfen, er habe damals den Genozid an bosnischen Moslems geleugnet, den die serbische Soldateska der Generäle Karadžic und Mladic zu verantworten hatte. Handke zeigte sich ungemein bockig, verweigerte Erklärungen, wetterte vielmehr gegen die Journalisten. Er werde nie mehr wieder mit ihnen reden. Was er in der Folge natürlich nicht tat.
Leicht und beschwingt
Und nun also diese Erzählung, in der jemand aufbricht, um Rache zu nehmen. Und zwar an einer Journalistin. Er will sie ermorden. Als die Verlagsvorankündigung diesen vermeintlichen Handlungsplot ausplauderte, rechnete der ein oder andere vielleicht schon mit dem Schlimmsten: Reitet sich der Dichter nun endgültig ins Verderben? Natürlich nicht. Erprobte Handke-Leser ahnten es bereits: Das wird ganz bestimmt etwas anderes werden als ein verbitterter Rachefeldzug. Dass es aber eine so leichte, beschwingte, selbstironische "Maigeschichte", wie es im Untertitel heißt, werden würde, verwundert denn doch und zaubert einem während der Lektüre mitunter ein Lächeln aufs Gesicht: Also bitte, es geht doch, das Triumphieren der Literatur über die Wirklichkeit.
Von nichts anderem erzählt diese Geschichte. Da zieht also einer los mit den bösesten Gedanken. Dieser "eine" ist wieder, wie bei vielen Büchern Handkes, seinem Verfasser zum Verwechseln ähnlich. Er lebt beispielsweise in demselben Pariser Vorort, und was er von seiner Mutter berichtet, kennen wir schon aus Handkes erfolgreichstem Buch, "Wunschloses Unglück", in dem er völlig fiktionslos und sehr ergreifend vom Leben und Freitod der Maria Handke, geborene Siutz, erzählt hat.
Die geradezu zur Heiligen verklärte Mutter ist es auch, die jetzt im neuen Buch gerächt werden muss. Denn die Journalistin, die zur Verantwortung gezogen werden soll, hat in verleumderischer Weise von ihr behauptet, sie habe als junge Frau den Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich freudig begrüßt. Eine Fotomontage soll es beweisen. Nichts davon jedoch stimmt.
Kein Wort über den Grund
Doch um all das zu erfahren, muss man schon rund ein Drittel des Buches hinter sich haben. Bis dahin verliert der Erzähler nämlich kein Wort über den Grund seines Rachefeldzugs. Der Mann ist eh etwas eigenartig, sehr leicht ablenkbar, es hat den Anschein, als vergäße er ganz einfach, wozu er eigentlich aufgebrochen ist. Er unterhält sich ununterbrochen mit sich selbst und ist auch sonst etwas zerstreut. Einmal schaut er zu seinen Füßen hinunter und sieht: Er hat zwei verschiedenfarbige Socken an.
Am laufenden Band macht er solche Detail-Beobachtungen. Sie sind es, die ihn letzten Endes von seinem Racheplan abbringen. Der Rächer in den verschiedenfarbigen Socken - dazu trägt er einen Dior-Anzug sowie einen Borsalino-Hut mit Bussardfeder im Hutband - verzettelt sich in der Welt nicht heillos, sondern Heil findend. Er wird geläutert von seinen ihn ja doch nur verfinsternden Rachegedanken und stattdessen in eine Mit- und Umwelt hineingezogen, die ihn nach und nach ganz in Beschlag nimmt. Ein Roadmovie der Besänftigung, könnte man sagen.
Da sind die Penner vom Bahnhofsvorplatz, die ihn aus ihrer Weinflasche trinken lassen. Oder das Briefträger-Ehepaar, das sich in die Ile-de-France versetzen hat lassen, weil sie beide die einzig Richtigen sind für die vielen "falschen Ebenen" der in einem Becken liegenden Pariser Stadt: Man sieht deren Steigungen kaum, spürt sie aber beim Pedaltreten.
Fast nur zu Fuß unterwegs
Wie alle Handke'schen Helden bewegt sich auch diesmal die Hauptfigur wieder nur zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einmal steigt sie in ein Taxi und der Fahrer kommt ihr vor wie die französische Ausgabe des berühmten Bluessängers Eric Burdon ... vielleicht ist er es ja, denn unverkennbar hat diese Erzählung etwas Märchenhaftes. So auch das Ende, von dem man nicht zu viel verrät, wenn man sagt, dass es natürlich zu keiner Ausführung des Racheplans kommt.
Der Held gerät stattdessen an der "Endstation-Gaststätte" seiner tagelangen Reise in eine Festgesellschaft, die ihn wie selbstverständlich aufnimmt. Und man darf ihn sich jetzt als einen augenblickslang glücklichen Menschen vorstellen, "ich saß noch eine Zeit allein an einem der vielen Tische, die sich erst allmählich feierabendlich bevölkerten und versank in die Betrachtung der alten Fußbodenbretter, wohl auch dank des im Lauf des Tages schwer gewordenen Kopfes".

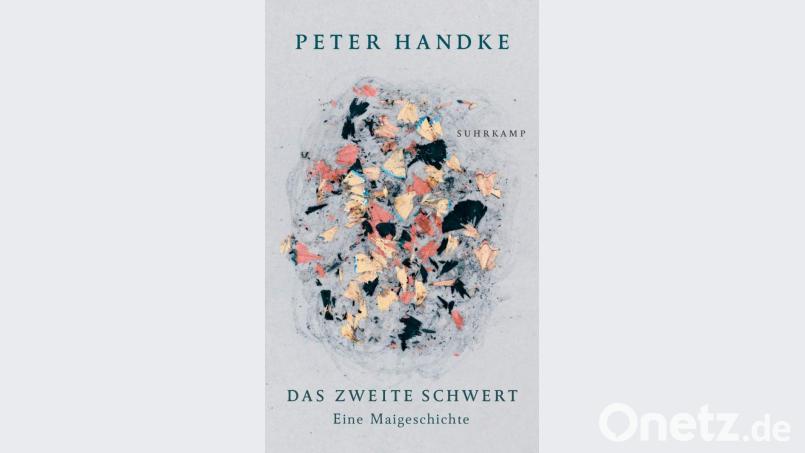













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.