Der estnische Komponist Jüri Reinvere hat sich bei dieser Auftragsarbeit durchaus etwas besonders einfallen lassen. Denn, wenn in einer Oper zum 250. Geburtsjahr Beethovens der gebürtige Bonner gar nicht persönlich in Erscheinung tritt, dann weist das schon eine gewisse Originalität auf. Zudem spielt Reinvere hier geschickt mit der Spekulation, ob die Angebetete, welche Beethoven in seinen Briefen als "unsterbliche Geliebte" bezeichnet, wirklich Josephine von Stackelberg war und ob deren Tochter Minona Beethovens Kind gewesen ist.
Weder Nein noch Ja
Wenngleich einige historische Umstände dafürsprechen, kann die Musikwissenschaft die Vaterschaft Beethovens in Bezug auf Minona von Stackelberg bis heute weder verneinen noch bejahen. Wirklich originell ist der zu Beginn der Oper eingespielte Filmausschnitt aus dem Jahre 1969, in denen sich Mauricio Kagel über einen Bauern lustig macht, der behauptet der letzte lebende Nachfahre Ludwig van Beethovens zu sein. Damit stellt Reinvere auf amüsante Weise den Bezug zu den Spekulationen über Josephine und Minona von Stackelberg her.
Das vom Komponisten selbst geschriebene Sujet behandelt das schwierige Leben der 1812 geborenen und 1897 verstorbenen Minona von Stackelberg, inklusive der Probleme mit ihrem herrschsüchtigen, baltendeutschen Vater Baron Christoph von Stackelberg, von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod. Ein wichtiges Element spielt dabei natürlich immer die Frage, wer ihr wirklicher Vater ist, die sich noch verschärft, als Minona im hohen Alter ermöglicht wird, die Liebesbriefe zwischen Beethoven und ihrer Mutter zu lesen.
Jüri Reinvere vermied geschickt auffällige Zitate aus Beethovens Werken zu verwenden und schuf hingegen eine moderne Tonsprache, welche sich oft eines flimmernden Klangteppichs der Streicher bedient, der sich an die Tutti-Trillertechnik von Richard Wagner anlehnt. Die Musik weist dadurch in langen Passagen einen mystischen Charakter auf, der nur durch ab und an ins Fortissimo gesteigerte Spannungsbögen unterbrochen wird.
Große Intervallsprünge
Die Partitur der Bühnenakteure ist mit wenigen Ausnahmen durch rezitativen Gesang geprägt, was teilweise an Richard Strauss' Oper "Intermezzo" erinnert. Darin eingeschlossen sind auch große Intervallsprünge einer zeitgenössischen Tonsprache, welche jedoch nicht zu experimentell ausfällt. Die vom Team um Regisseur Hendrik Müller gestaltete Inszenierung mit Klavierflügel, Orgel inklusive Orgelpfeifen, Metallkäfig, Bibliotheksecke und noch zahlreichen kreativen Details vermag durchaus zu fesseln, was auch an den gut durchdachten Bewegungsabläufen, inklusive der Drehbühne liegt. Auch die Video-Livestreams bereichern das Bild.
Die Tonsprache stellt keine geringen Anforderungen an die Bühnenakteure. Deshalb gebührt allen Sängerinnen und Sängern großes Lob. Vor allem bestechen Theodora Varga als Minona, Anna Pisareva als Josephine und junge Minona sowie Vera Seminiuk als Gräfin von Goltz und Adam Krusel als Baron von Stackelberg. Das Orchester nahm sich unter Leitung von Generalmusikdirektor Chin-Chao Lin der Partitur mit Einfühlungsvermögen an und lotete die Spannungsbögen bis auf den Grund aus. Der Applaus im gut besuchten Theater am Bismarckplatz war für alle Beteiligten zurecht intensiv und anhaltend.





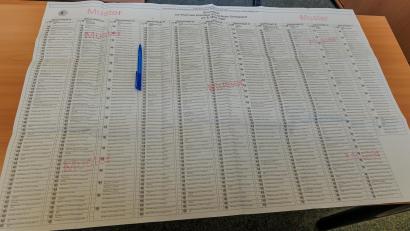








Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.