Der Eschenbacher Kulturhügel lockte Mundartfreunde aus einem weiten Umkreis an. Mit Professor Ludwig Zehetner hatte der Heimatverein für den Auftakt der Mundarttage einen Germanisten und Anglistiker angekündigt, der die Eigenheiten und Reize überlieferter Sprachkultur quasi "zelebriert".
„Der preußische Einheitsbrei tut der deutschen Sprache Gewalt an und drangsaliert unsere Sprache“, erklärte der Referent etwa, Seine Würdigung altbairischer Rituale gipfelte in der Forderung: „Den bayerischen Kosmos gilt es zu erhalten.“
In der Aula der Markus-Gottwalt-Schule hieß Karlheinz Keck, der Vorsitzende des Heimatvereins, mit dem gebürtigen Freisinger einen bayern- und deutschlandweit bekannten Fachmann willkommen, der sich als stellvertretender Schulleiter am Gymnasium der Regensburger Domspatzen, Mitarbeiter der Kommission für Mundartforschung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München sowie als Lehrbeauftragter und Honorarprofessor für Dialektologie des Bairischen an der Universität Regensburg hohe Verdienste erworben habe. Seine literarischen Werke brachten ihm den Bayerischen Poetentaler der Münchner Turmschreiber, den Literaturpreis des Oberpfälzer Jura und die Bürgermedaille des Marktes Lappersdorf ein.
Die nahe zweistündige Veranstaltung würzte der Gast mit steten Wort- und Lautspielereien. Als er die feinen Unterschiede zwischen Althochdeutsch und Nordoberpfälzisch herausstellte, sprach er von phänomenalen Einblicken in die deutsche Sprachgeschichte.
Wiederholt zitierte Zehetner dabei Texte Eugen Okers als Beispiele für charakteristische Lautformen: „Ou wäiala! Gäih zou, Bou! Lou ma mei Rouh! Woarum solds nouchand niad ins Wiazhaus güi.“
Er befasste sich zudem mit den zum Teil unverständlichen Unterschieden zwischen oberbairischer, mittelbairischer und nordoberpfälzischer Mundart und nannte dazu als Beispiele Wörter wie „Or“ und „Euer“ für Eier.
Die Frage „Was zeichnet das Bairische insgesamt aus?“ brachte er auf einen einfachen Nenner: „Ein helles A.“ An den Lippenbewegungen seiner Zuhörer war zu erkennen, wie begeistert sie sein „Rabawa-Mamadad“ nachahmten.
Bei seinen Betrachtungen zur Sprachökonomie kam der Referent auch auf die im Dialekt mitunter deutliche Silbenreduktion zu sprechen, wie sie auch im Englischen üblich ist. Als Beispiel dafür führte er „Hods grengt?“ für „Hat es geregnet?“ an.
Er sah in der regionalen Muttersprache ein „Kulturgut ersten Ranges“ und beschrieb Bairisch als „konkret, lebensnah, ungeschminkt, direkt und drastisch“. Anleihen dazu nahm er bei Josef Hefmüller (1872 bis 1923): „Unsere Mundart ist so edel und fein, sie hat eigene Qualitäten und lässt sich festmachen in der Fülle des Wortschatzes.“
Mit Nachdruck versicherte Zehetner: „Dialekt macht schlau, doch leider soll er den Kindern ausgetrieben werden.“ Dass Dialekt jedoch einen Lernvorsprung schaffe, bewies er mit Hinweisen auf die Ergebnisse der Pisa-Studien: „Dialektkinder sind besser; Zweisprachigkeit fördert die Synapsen.“
Ludwig Zehetner rief nicht nur deshalb die Zuhörer auf, nicht dem „Wahn der deutschen Einheitssprache“ zum Opfer zu fallen und würdigte die Altehrwürdigkeit der Dialekte in der Region. Den Verzicht auf kulturelle und sprachliche Vielfalt verglich er mit dem Verzicht auf Musik und Kunst.
Es folgte ein reger Sprach- und Begriffaustausch mit Wortspielereien zwischen Zuhörern und Referenten. In regelmäßigen Abständen begleitete die „Schleif-Band“ Zehetners Ausführungen. Mit einem Tango entführte Uschi Steppert abschließend nach Argentinien und sorgte damit für den musikalischen Höhepunkt des Abends.




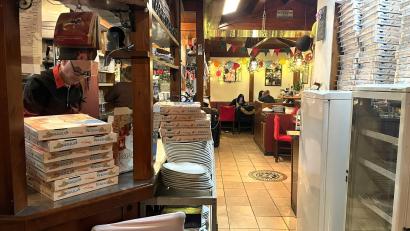










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.