Vorausgegangen waren am 15. und 22. April 1948 die Verlosung von 22 der 24 nur provisorisch abgemessenen Grundstücke zu jeweils etwa 35 Dezimalen (eine entspricht einem Hundertstel tagwerk, also etwa 34 Quadratmeter, Anm. d. Red). Der Anlass dazu war die von der US-Militärregierung 1947 geforderte Räumung der im Truppenübungsplatz gelegenen Orte Römersbühl, Boden im Thal, Netzart im Thal, Weihern, Schlattermühle und Netzaberg. Betroffen davon waren 206 Einheimische sowie 157 Vertriebene und Flüchtlinge.
Sie alle suchten eine neue Bleibe. Der Räumungsbescheid folgte am 14. April 1948. Die Stadt verpflichtete daraufhin die Lkw-Besitzer Michael Wolfram, Anton Kraus, Karl Schrembs, Otto Band, Wladislaus Wlomanski (alle Eschenbach), Berthold Heinze (Thomasreuth), Michael Bitterer und Erwin Koppe (beide Stegenthumbach), die bis 19. April angeordnete Räumung sicherzustellen.
Mit ihrer Unterschrift verpflichteten sich die Bewerber um die Grundstücke, mit dem Loszuschlag auf folgende Bedingungen einzugehen:
„I. Die Bauweise muss nach den Vorschriften eines zu erstellenden Bebauungsplanes durchgeführt werden. Die jetzige Absteckung ist nur ein Provisorium. Die Festsetzung der Grenzen der einzelnen Grundstücke erfolgt erst. Die zu errichtende Straße entlang der Grundstücke muss erweitert werden. Soweit sich die Notwendigkeit ergibt, wird zwischen den einzelnen Grundstücken von Süden nach Norden ein schmaler Verbindungsweg gezogen.
II. Für Wasserversorgung haben sich die Beteiligten selbst zu kümmern. Vor der Inanspruchnahme der Grundstücke ist die Wasserfrage selbst zu klären.
III. Die Stadt Eschenbach gestattet den Landwirten, auf den ihnen durch Verlosung zugesprochenen Grundstücken einstweilige Notstandswohnungen errichten zu lassen, bis an den ordentlichen einheitlichen Bau der Wohnhäuser herangegangen werden kann. Sollte nach einem noch festzusetzenden Termin der betreffende Eigentümer des Loses nicht gewillt sein, mit der Bautätigkeit zu beginnen, so verliert er das Anrecht auf die Pachtung und Nutzung des Grundstückes. Entschädigungen irgendwelcher Art kann er in diesem Falle von Seite der Stadt nicht beanspruchen.
IV. Der Pachtpreis für die einzelnen Grundstücke wird durch einen Beschluss des Stadtrates noch festgelegt.“
Bis zur endgültigen Vermessung der Apfelbacher Parzellen im Jahr 1949 hatte sich deren Gesamtzahl auf 27 erhöht. Der Kaufpreis lag zwischen 30 und 44 Pfennig pro Quadratmeter. Bei der Errichtung der Wohnhäuser dienten die aufgelassenen Ortschaften im Truppenübungsplatz als Steinbrüche.
Aufgrund der Losentscheidungen 1948 gingen die Parzellen an: Richard Raithel (stammend aus dem Egerland), Josef Kraus, Georg Pemp, Anton Horack (Bukowina, Buchenland), Eugen Buhre (St. Petersburg), Wolfgang Dobmeier, Josef Held, Martin Stopfer, Oswald Cermak (Nordmähren/Sudetenland), Ignaz Wurm, Emilie Fuchs (Bukowina), Michael Neumüller, Ernst Hampel (Schlesien), Johann Pscheidt (Bukowina), Alex Cermak (Sudetenland), Franz Henfling, Johann Hasenkopf (Bukowina), Ferdinand Augustin (Bukowina), Norbert Pscheidt (Bukowina), Lukas Erl (Bukowina), Alois Mehren und Johann Bernhardt.
Die ersten Jahre in der stets wachsenden Siedlung waren entbehrungsreich. Als erster Ortsvorsteher amtierte Franz Henfling. Bei einer Ortsversammlung am 12. April 1953 betrauten die Siedler mit dieser Funktion Johann Bernhard, zum Stellvertreter machten sie den Steuerberater Egon Seigerschmidt.
Bereits am 16. März 1953 hatten die Bewohner bei einer Protestversammlung ihrem Ärger Luft gemacht, denn die Wasserversorgung war nach wie vor katastrophal. Trinkwasser musste aus einem von einer Quelle gespeisten Bassin am Rande der Siedlung oder aus Eschenbach geholt werden. Als Entnahmestelle diente auch eine Quelle an der Straße nach Eschenbach.
In einem Schreiben forderten die Bürger Abhilfe und erinnerten daran, dass sie sich „ihre Häuser abgehungert“ haben. Die Brunnen beschrieben sie als "Wasserlöcher, die Mäuse, Frösche und Würmer verunreinigen". Egon Seigerschmidt fuhr mit Bildern zur Regierung nach Regensburg, um „der Stadt Dampf zu machen“.
Außer dem Wasseranschluss fehlten der inzwischen auf 50 Häuser angewachsenen Siedlung im Jahr 1955 auch noch Straße, Beleuchtung und Kanalisation. Der Anschluss an das städtische Wassernetz wurde noch im gleichen Jahr realisiert. Von 1961 bis 1965 folgte der Bau des ersten Kanals mit Trennsystem. Oberflächenwasser und Hausabwässer flossen nun in den Truppenübungsplatz. Der Wert der dafür erbrachten Hand- und Spanndienste wurde mit 35 849 D-Mark veranschlagt.
Die Zufahrt zu den Grundstücken führte über einen Hohlweg und auf Feldwegen, alle unbefestigt und bei Nasswetter kaum befahrbar. Erst im Oktober 1952 ließ die Stadt Basaltschotter für eine Rollierung anfahren. 1953 folgte ein Provisorium aus Rolliersteinen und Sand mit gewalzter Oberfläche, das erst mit dem Straßenbau 1967 ein Ende fand.
Die erste Wirtsstube in Apfelbach gab es bei der Eisenbahnerfamilie Horak neben der damaligen Bahnlinie. Die Horaks hatten zunächst, wie in der Ukraine üblich, aus Stangen und Lehm ein Wohngebäude errichtet. Im anschließend gebauten Haus eröffneten sie eine kleine Gaststätte, die auch der Nachbesitzer noch einige Zeit betrieb.
Eine weitere Gaststätte eröffnete im östlichen Ortsteil die Familie Czermak. Sie wurde vom Ehepaar Weiß übernommen und schließlich lange Zeit von Fini Pemp betrieben. Ab Oktober 1988 war für mehrere Jahre die „Apfelbacher Schänke“ der Familie Kraus Mittelpunkt des geselligen Lebens.

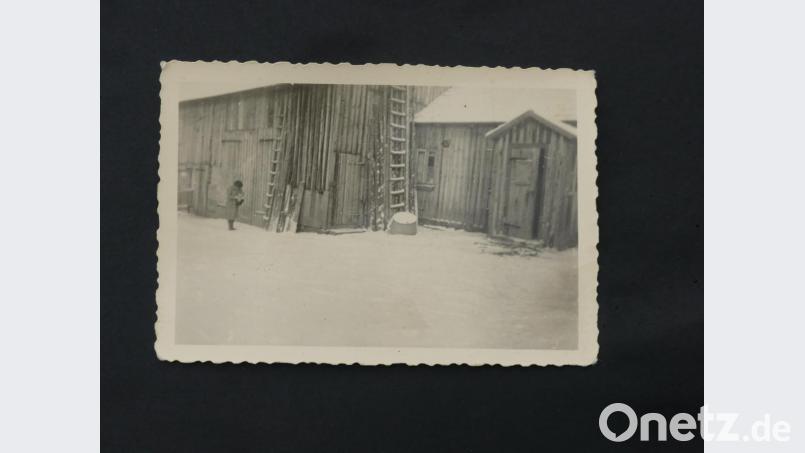

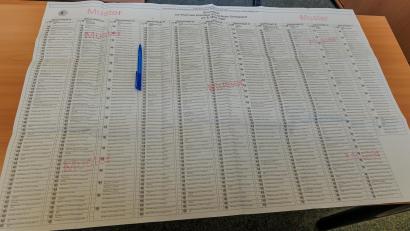












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.