Ob sie unter fairen Arbeitsbedingungen gezüchtet und innerhalb von 48 Stunden in den Laden transportiert oder gar mit hochgefährlichen Pestiziden behandelt wurde, verrät die rote Rose auf dem Tisch nicht. Für viele Käufer ist das alles nur selten ein Thema.
Blumen waren nur ein Beispiel bei der Veranstaltung der Demokratie-Werkstatt des Netzwerks Inklusion Landkreis Tirschenreuth, "Halten wir uns Sklaven?" lautete der Titel der Zusammenkunft im Mehrgenerationenhaus. Christina Ponader und Friedrich Wölfl stellten die Zielsetzung vor: den Zusammenhängen zwischen Lebensstil und Konsum mit den Arbeitsbedingungen für Menschen in aller Welt nachspüren. Dabei gehe es nicht darum, Mitleid, Betroffenheit oder Gewissensbisse zu erzeugen, so die Organisatoren. Vielmehr wolle man dazu beitragen, die hochkomplexen Zusammenhänge etwas mehr zu durchschauen. Das führe nicht sofort zu verändertem Verhalten, wie Forscher ermittelt hätten, aber vielleicht ließen sich kleine Stellschrauben drehen.
Ein aufmerksamer Rundgang im Haushalt könne schnell die Augen öffnen. Referent Friedrich Wölfl präsentierte Artikel mit ihren Herkunftsorten: Tomaten aus Spanien, Winterschuhe aus der Slowakei, Mandarinen aus Marokko, T-Shirts aus Bangladesch, Socken aus Serbien, einen Mantel aus Rumänien, Baumwolle aus der Ukraine, Akkus mit Coltan aus dem Kongo, Soße mit Tomaten aus China, Kakaobohnen aus Ghana, Erdnüsse aus Ägypten, Lippenstifte mit Glimmer aus indischen Minen, eine Gartenschere aus Japan, Blütenhonig aus Mexiko: Dass man quasi die ganze Welt in der eigenen Wohnung habe, sei vielen im Alltag gar nicht bewusst.
Miserable Bedingungen
Und was noch wichtiger sei, wie Wölfl betonte: Zu jedem Produkt gehöre eine Lieferkette, oft mit Näherinnen, denen Löhne unterhalb des Existenzminimums gezahlt würden, mit Zwangsarbeitern, mit Kinderarbeit nicht nur in Asien und Afrika, mit miserablen Arbeits- und Umweltbedingungen, mit schikanierten Matrosen auf Containerschiffen. Der Blick auf Ursprungsländer, auf Modelabels, Etiketten oder die Aufschriften auf Geräten oder Spielzeug könne allein schon erhellen.
Die Zusammenhänge zwischen dem Konsumverhalten und den Folgen auf den Ressourcenverbrauch wie auch auf die Arbeitsbedingungen in den Lieferketten sollten den Teilnehmern zwei Online-Tests erschließen. Es seien vor allem drei Bereiche, die unsere Lebensstile charakterisieren: Neben Ernährungsgewohnheiten und Wohnen spiele die Mobilität eine große Rolle, sei es das tägliche Autofahren oder der Urlaubsflug nach Sri Lanka. Jeder Teilnehmer konnte auf den vom Jugendmedienzentrum T1 zur Verfügung gestellten Tablets Antworten auf ein Dutzend Fragen eingeben, die Software rechnete dann ein ungefähres Ergebnis aus. Zunächst ging es um den "ökologischen Fußabdruck", also zur Frage: Wie viel Hektar Erde verbrauche ich im Jahr? Bei 1,7 "Global-Hektar" (gha) könnte sich die Erde jährlich regenerieren, der Deutschlandschnitt liege bei 5 gha, der Weltdurchschnitt bei 2,8. Eine Teilnehmerin dazu: Auch bei geänderten Eingaben könne man bei unserem Lebensstandard den gha-Verbrauch nicht einschneidend verringern.
Verhalten überdenken
Der zweite Selbsttest zielte auf die Titelfrage. Ein "Sklavenabdruck" versucht anhand des eingegebenen Konsums eine ungefähre Zahl von "Sklaven" zu errechnen. Mit "Sklaven" sind ganz allgemein unmenschliche Lebensbedingungen gemeint. Es sei nicht nur ein Gedankenspiel und man könne methodisch manches einwenden, meinte der Referent, außerdem gehe es nicht um kommagenaue Ergebnisse. Die Initiatoren des Tests hätten aber Lieferketten zu mehr als 400 Alltagsprodukten recherchiert. Ihr Ziel: Nachdenken über das eigene Verhalten in verschiedenen Lebensbereichen könnte immerhin zur Erkenntnis führen, dass man öfter auch Wahlmöglichkeiten habe.
Klar wurde dabei, dass man die Globalisierung nicht rückgängig machen und der Einzelne nicht die Welt retten kann. Aber man könne aus den vermuteten 47 "Sklaven", wie sie einer der Tests ergab, vielleicht "nur" 35 machen. Man müsse sein Leben deswegen nicht völlig ändern, kleinere Korrekturen würden oft reichen.
Die Zusammenhänge zwischen Lebensstilen, Marketingstrategien von Produzenten und Handelsfirmen, Umwelt- und Lobby-Politik, soziale Standards und wirtschaftlichen und politischen Strukturen seien hochkomplex, so der Referent. Um etwas zu ändern brauche man gut informierte Verbraucher, mitunter kritische Nachfragen zu Lieferketten und Transparenz bei Labels und Kontrollen. Und es seien gut informierte Politiker, die zwischen Interessen klug abwägen würden, nötig.
Selbstverpflichtungen bei Produzenten und Handelsfirmen könne man nur begrenzt vertrauen, vor allem, wenn sie sich Auskünften oder Kontrollen verweigerten, so eine Feststellung in der Runde. Kooperationspartner bei der Veranstaltung waren die Volkshochschule und der Kreisjugendring Tirschenreuth. Gefördert wurde sie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben".




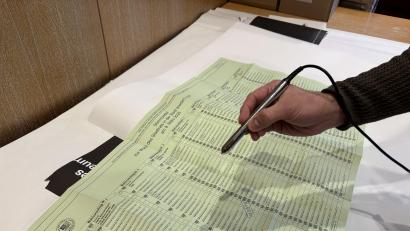










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.