Christina Ponader und Friedrich Wölfl von der Demokratie-Werkstatt im Netzwerk Inklusion hatten mit der Volkshochschule und gefördert von „Demokratie leben“ ein besonderes Programm vorbereitet. 24 Teilnehmer machten sich laut Pressemitteilung mit ihnen auf den Weg durch den Landkreis: Die Stationen waren das Atommüll-Zwischenlager, ein griechisches Restaurant in Mitterteich, das Naturschutzgebiet Teichelberg, eine Auseinandersetzung mit Sudetendeutschen in Wiesau, der Wasserspeicher Gumpen und der Zoigl in Falkenberg. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie entstand und entsteht Identität über Zoiglkultur, Karpfenweg oder unseren Dialekt hinaus?
Eine erste Antwort gab Gerhard Wehner, langjähriger Vorsitzender der „Bürgerinitiative gegen Atommüll“, mit seinem Rückblick auf die Auseinandersetzung mit dem Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Mitterteich seit den 1980er Jahren. Anhand von zahlreichen Fotos erinnerte er an die Ereignisse. Der Widerstand gegen das als autoritär empfundene Vorgehen der bayerischen Staatsregierung sei in kurzer Zeit auf breite Zustimmung gestoßen. Parallelen zu Wackersdorf seien zu erkennen. Bei Demonstrationen solidarisierten sich bis zu 6000 Demonstranten aus Mitterteich und der Region.
Unterstützung fand man beispielsweise auch bei der Biermösl-Blosn mit Gerhard Polt, beim Bund Naturschutz, bei Greenpeace, örtlichen Vereinen, Kommunalpolitikern und Nachbarstädten. Die Mobilisierung gelang überraschend schnell über Telefonketten und Mundpropaganda. Mit dem Fortschreiten der Genehmigungsverfahren schmälerte sich die Protestbasis. Um nicht auf behördliche Auskünfte angewiesen zu sein, betreibe man bis heute eigene Messstellen.
Heimat entstehe also im gemeinsamen Engagement – in den „Graswurzel-Bewegungen“ die kritisch Politik begleiten und gestalten wollen. Ziel sei es, die Zukunft des eigenen Ortes nachhaltig und ganzheitlich zu sichern.
Ein zweites Thema war der Naturschutz. Auf der Kuppe des Teichelbergs bei Pechbrunn erläuterte der Vorsitzende des Bunds Naturschutz, Josef Siller, die langjährigen Bemühungen, das Waldreservat "Gitschger" am Teichelberg bei Pechbrunn zu erhalten. Hier standen sich immer wieder wirtschaftliche und naturschützerische Interessen gegenüber. Beim Blick auf lange Zeiträume, wie sie die Natur für ihren Erhalt braucht, ermöglicht das Reservat in besonderem Maße den Schutz der Naturkreisläufe für Pflanzen wie für alle anderen Lebewesen.
Josef Siller sprach von dem Waldgebiet als „Arche Noah“ für Hunderte von Tierarten: Uhu, Wildkatze, Fledermaus und als verschollen geltende Schmetterlingsarten sind nur einige Beispiele. Ein besonderes Erlebnis war für die Teilnehmer der Blick in den Steinbruch, weil er die Dimensionen des Abbaus zeigte. 2018 wurde der Antrag des Basaltwerks auf Erweiterung des Basaltabbaus endgültig abgelehnt - der Steinbruch wird künftig renaturiert.
Das zivilgesellschaftliche Engagement war mitentscheidend und hatte auch Erfolg. Heimat sichern heiße hier, einzigartige und nicht wiederherstellbare Naturräume vor kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen zu sichern.
Eine weitere Variante für Engagement und kritischen Widerspruch zeigte sich bei einer Aktion in den 1970er Jahren im Raum Gumpen. Klaus Arbter aus Tirschenreuth erläuterte den Teilnehmern mit direktem Blick auf die Waldnaabauen die damaligen Planungen zum geplanten Stausee. Die Behörden hätten versucht, ein Vorhaben durchzusetzen, das aus seiner Sicht von Anfang an "sachlich nicht zu begründen war". Das Wassermanagement des Freistaats plante bis zu 30 große Stauseen in Bayern im Zug der Planungen für den Main-Donau-Kanal. Sie sollten den Donauwasserstand regulieren.
In den Waldnaabauen rund um Gumpen war ein rund 470 Hektar großer Stausee geplant. In der Region warben die Behörden zunächst bei Bauern, Gemeinden und bei der Bevölkerung für den See. Er würde als Erholungsort neue touristische Möglichkeiten in die strukturschwache Gegend bringen. Arbter rechnete damals mit einem Expertenteam die behördlichen Angaben nach und kam zu dem Ergebnis: im Sommer hätte bei Niedrigwasserstand die Wasserfläche kaum noch 20 Hektar betragen und wegen mangelnder Tiefe wären die Ufer zu riesigen Schlamm- und Schilfflächen geworden, die in keiner Form touristisch nutzbar gewesen wären.
Als Natur- und Landschaftsschützer sah er außerdem die Waldnaabauen bedroht. Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz und einem kleinen Team im Oberpfalzverein nahm Arbter den Kampf auf und scheute zusammen mit betroffenen Landwirten auch vor gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht zurück. Schließlich setzte 1981 das Verwaltungsgericht Regensburg dem Ganzen ein Ende. Noch heute merkt man dem Tirschenreuther die Genugtuung an: "Die Richter hatten alle von den Aktivisten vorgelegten Argumente und Belege übernommen und das Projekt verboten".
Das dritte Thema der Fahrt drehte sich um Neu-Ankommende: An der Stele zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Sudetendeutschen gab Walter Wenisch in Wiesau einen lebendigen Einblick in seine Lebensgeschichte. Die Familie Wenisch verließen die Region Chodau, heute Chodov, unter den Umständen des Jahres 1945 in einem Vertriebenenzug. Ihre erste Station war nur zufällig Tirschenreuth. Später sei die Familie in einen Bauernhof in einem nahen Dorf zwangseingewiesen worden.
Anhand kleiner Episoden zeigte Wenisch, dass es die „Flüchtlingsfamilie“ dort nicht einfach hatte. Andererseits musste er nie Hunger erleiden und erfuhr nie irgendwelche Formen von Gewalt. Bei den Dorfkindern war der Bub schnell angesehen, weil er gut Fußball spielte und stets als „Erster“ gewählt wurde. Ein engagierter Lehrer lenkte ihn auf das St. Peter-Gymnasium, ein Lehrerstudium schloss sich an.
Schließlich landete er in Mitterteich, heiratete eine Mitterteicherin und engagierte sich in der Kommunalpolitik und in verschiedenen Vereinen. Als „Flüchtling“ werde er seitdem überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Für seinen Lebensweg habe die Vertreibung keinerlei Hindernisse mit sich gebracht, aber durchaus gewisse Prägungen: Wenisch betrachtet sich als Einheimischer, gleichzeitig aber auch als „Vielheimischer“ oder auch als Heimatnomade.
Die von Walter Wenisch geschilderten Erlebnisse als Vertriebener dürften nicht typisch sein, meinte Horst Adler, Kreisvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Er wies in seinen Beiträgen darauf hin, dass viele Sudetendeutschen schlimme und traumatische Erfahrungen machen mussten. Es seien nachweislich auf der Flucht auch viele umgekommen. Das Durchgangslager Wiesau habe seine eigene Geschichte. Es gebe noch Zeitzeugen, die auch länger hier in den Baracken wohnen mussten.
Eine ganz andere Geschichte des Ankommens erzählte die Familie Kotsekoglou aus Mitterteich. Anthimos Kotsekoglou betreibt dort seit mehreren Jahren erfolgreich ein griechisches Restaurant. Seine Familie ist seit den 1960er Jahren mit Mitterteich verbunden. Damals seien seine Großeltern vom deutschen Staat und deutschen Unternehmen angeworben worden. Eine Zentralstelle in München habe sie eher zufällig auf Industriestandorte verteilt.
So seien sie als „Porzelliner“ in Mitterteich gelandet, damals als sogenannte Gastarbeiter, immer auch mit der Perspektive, nach Griechenland zurückzukehren. Aber Mitterteich sollte auch für die nächsten Generationen immer mehr zum Lebensmittelpunkt werden, wenn auch mit Unterbrechungen. Die Kontakte und Bezüge zu der Stadt hätten sich verstärkt. Dies zeige sich an der Geschichte der 17-jährige Tochter Dimitria eindrucksvoll: Sie hatte an der Mitterteicher Mittelschule einen soliden Mittleren Abschluss absolviert und ist jetzt mit vollem Herzen auf dem Weg in einen medizinischen Beruf. Für sie selbst ist wie für ihre Eltern klar: „Meine Zukunfts- und Lebenschancen sind hier.“ Natürlich wisse sie um ihre Wurzeln, die sie sich auch erhalten werde.
Fast beruhigend und für die Teilnehmer des Heimat-Tags eher überraschend der Rückblick der Eltern und der Tochter: „Nein, weder in der Arbeitswelt noch in der Schule oder sonst sind wir in Mitterteich wegen unserer Herkunft auf Vorbehalte gestoßen.“







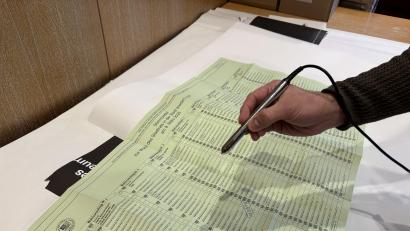










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.