Eigentlich klingt es logisch, dass eine unverfugte Spalte zwischen zwei Kopfsteinpflastersteinen einem Rollstuhlfahrer schnell zum Verhängnis werden kann. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber aber noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ich bin 25 Jahre, habe gerade meinen Abschluss an einer Universität gemacht und arbeite jetzt in der Lokalredaktion von Oberpfalz-Medien. Eine körperliche Beeinträchtigung habe ich nicht. Ein Perspektivenwechsel könnte aber nicht schaden.
Selbstversuch mit Alex
Ich treffe mich mit Alexander Grundler. Er ist der kommunale Behindertenbeauftragte der Stadt Weiden. In seinem Büro steht schon ein Rollstuhl bereit. Ich klappe ihn auseinander und setze mich rein. Alex gibt mir eine kurze Einweisung.
Danach geht es los. "Mach doch mal die Tür auf", sagt er. Ich denke mir: "Okay, klar mach ich." Beim Umdrehen fahre ich dann gleich mal an einen Schrank, bleibe kurz ganz stecken. Als ich versuche, die Tür zu öffnen, kippe ich fast aus dem Stuhl. "Am Anfang ist das ganz normal", beruhigt mich Alex. Schon hier bekomme ich zu spüren, dass es gar nicht so einfach ist, für einen Tag im Rollstuhl zu sitzen. Sehr hilfreich: der Aufzug. Er ist breit gebaut, hell ausgeleuchtet, die Tasten groß und die Sprachausgabe sagt, in welchem Stockwerk wir uns befinden. In meinem Fall hilft der Spiegel ungemein, um rückwärts wieder herauszukommen.
Auf die harte Tour
Alex bietet mir an, ich könne mich entscheiden, welche Route wir fahren. "Die leichte oder die harte Tour?", fragt er. Ich sag' sofort: "Machen wir die harte Tour." Schon nach ein paar Hundert Metern merke ich, dass ich da wohl zu vorschnell war. Meine Arme fangen an zu brennen. Alex fährt mir davon. "Jeder der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich in einem sehr gemütlichen Tempo fahre", scherzt er, als er sieht, wie ich zu kämpfen habe. Zwei Stunden später werde ich die Blasen an meinen Fingern entdecken.
Zuerst fahren wir durch den Max-Reger-Park. In die Altstadt zu kommen, ist schwer. Das erste Mal bremsen uns Treppen aus und beim Zweiten Mal ist die Steigung auf Höhe der Realschulen zu steil. "Wenn die Stadt etwas saniert, dann achtet sie darauf, barrierefrei zu bauen", sagt Alex. Sechs Prozent, höher sollte eine Steigung nicht sein, weiß er.
In der Stadt beginnt das Kopfsteinpflaster. Um vorwärts zu kommen, braucht es jetzt mehr Kraft. Aber es geht. Problematischer sind die Regenabflussrinnen aus größeren Steinen in der Mitte. "Manchmal ist es schwierig, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen", erklärt Alex, während ich versuche wieder aus der Rinne herauszukommen. Für Menschen mit einer Sehbehinderung dient die Rinne oft als Orientierung. Sie wissen dann zum Beispiel, wann sie an einem bestimmten Geschäft angekommen sind. Für Rollstuhlfahrer dagegen birgt die Rinne Probleme, erklärt er.
Buden mit und ohne Stufe
Auf dem Weihnachtsmarkt angekommen, drehen wir erst einmal eine Runde. Hinter dem Rathaus steht eine Bude, die eine Stufe vor der Verkaufstheke hat. "Die steht auf einem Podest, die muss da einfach irgendwie hingestellt werden. Wenn ich nach Hilfe frage, dann helfen sie mir selbstverständlich", sagt er.
Menschen mit Behinderungen möchten aber selbstständig an der Gesellschaft teilhaben und teilnehmen. In der Mitte des Weihnachtsmarkts steht eine erhöhter Pavillon, in dem die Besucher Glühwein trinken. Er hat auch eine Rampe für Rollstuhlfahrer. "Das ist an und für sich eine sehr gute Sache, da hat sich jemand Gedanken gemacht", meint Alex. Das Problem: Die Rampe ist leider ein bisschen zu steil. "Das ist sicherlich keine böse Absicht. Wir können den Leuten aber sagen: Mensch, schau doch mal, da gäbe es noch eine Option, um das besser zu machen". Es gibt aber auch Dinge, die von den Budenbetreibern wahrscheinlich ganz unbewusst so gestaltet wurden, dass sie den Ansprüchen von Menschen mit Behinderung gerecht werden. Zum Beispiel: Als wir an den Ständen vorbei fahren, weist mich Alex darauf hin, dass die Preisschilder in gut leserlicher Schrift genau auf unserer Augenhöhe angebracht sind. Es gibt Mülltonnen, bei denen ich den Deckel nicht aufmachen und halten muss. Zwischen drin sagt Alex: "Wenn es jetzt voller wäre, dann hätten wir lauter Hintern im Gesicht. Tja, so ist das halt", und lacht.
Was Sprache alles kann
Zurück am Rathaus spüre ich meine Arme. Alex gibt mir noch etwas mit auf den Weg, das mich auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. "Auch im Journalismus ist Inklusion ein wichtiges Thema", sagt er. Eigentlich betrifft das nicht nur das Schreiben, sondern auch unsere Alltagssprache.
"Zu einem Menschen mit Sehbehinderung sagen, wir sehen uns morgen, das ist okay. Das ist unser normaler Sprachgebrauch." Dennoch gibt es gewisse Standards, die jeder beachten sollte. "Man kann sich überlegen, ob man vielleicht anstelle von Menschen mit Behinderung zu sprechen, lieber sagen sollte, dass das Menschen sind, die von ihrer Umwelt behindert werden", sagt Alex. Ich glaube, ich kann jetzt nachvollziehen, was er damit meint.




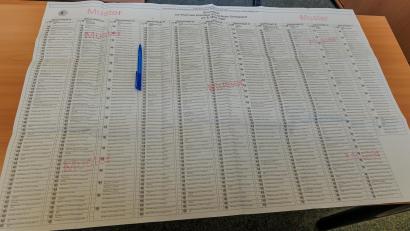










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.