Nach dem Schubert/Janaček-Zyklus vor vier Jahren widmet sich Herbert Schuch diesmal einem musikalischen Meilenstein: Ludwig van Beethovens 32 Klavier-Sonaten mit den großen Klassikern „Appassionata“,„Waldstein“, „Pathétique“, „Mondscheinsonate“, „Pastorale“, „Les Adieux“ und „Hammerklavier“. Die Kulturredaktion wollte mehr zum zweijährigen Großprojekt wissen:
ONETZ: In der Spielzeit 2014/15 waren Sie mit einem Schubert/Janaček-Zyklus zu Gast im Stadttheater Amberg, ab Januar 2019 kehren Sie mit dem Beethoven-Sonaten-Zyklus zurück. Was ist so reizvoll an der Serie?
Herbert Schuch: Die Sonaten von Beethoven sind immer noch - mehr als 200 Jahre nach ihrer Entstehung - der größte und bedeutendste Schatz für die Klavierliteratur. Zudem auch eine ungemein spannende Reise durch den Lebens-und Kompositionszyklus Beethovens. Man kann auf unglaublich intime Art alle Phasen in Beethovens Schaffen verfolgen, vom jungen Heißsporn bis zum tauben, der Welt schon entrückten Visionär. Das alles nur mit einem Klavier auf dem Podium mit dem Publikum zu teilen, ist schon etwas ganz Besonderes und war für mich ein Herzenswunsch. Und mit 40 Jahren fühle ich mich langsam reif dafür.
ONETZ: Der Pianist und Dirigent Hans von Bülow erhob die 32 Sonaten zum „Neuen Testament“ der Klavierliteratur. Wie gewinnt man einem solchen „Klassiker“ neue, indivduelle Aspekte ab?
Um neue und individuelle Aspekte muss man sich keine Sorgen machen: Die gibt es bei jeder Interpretation, da es ja nie zwei identische Interpretationen gibt. Die Frage ist nur: Was genau versteht man unter Interpretation? Für mich ist es erst einmal wichtig, nachzuvollziehen, welche Grundidee, welcher Charakter hinter jedem einzelnen Satz steckt und wie man sie am besten realisiert. Beethoven verlangt ja so viel. Man muss als Interpret ja erst mal das alles kauen und verdauen, bis sich eine Klarheit beim Spielen einstellt. Ich halte nichts davon, Dinge absichtlich anders zu machen, nur um interessant zu wirken. Ich glaube, wir Interpreten scheitern viel öfter an diesen großen Werken als man es zugeben möchte. Um es positiv auszudrücken: Interpretation ist „work in progress“ und nie fertig. Brendel sagte mir vor einigen Jahren, als er schon längst seine Karriere beendet hatte, dass er erst jetzt beim Spielen mancher langsamen Sätze von Beethovensonaten das Gefühl habe, die Stücke zu verstehen. Mit 80 Jahren, nach einem Menschenleben mit dieser Musik. Man hätte da zu gern Mäuschen gespielt.
ONETZ: Sie zählen zum erlauchten Kreis der Pianisten, mit denen der große Alfred Brendel seinen Erfahrungsschatz teilt – wie sehr hat Sie dessen Aufnahme der Sonaten beeinflußt?
Ehrlich gesagt: Ich habe seine zahlreichen Aufnahmen der Beethovensonaten kaum gehört, mit nur einigen Ausnahmen. Allerdings habe ich mit ihm an der Sonate op. 111 gearbeitet, als er noch selber als Pianist aktiv war. Unvergesslich war für mich, wie er den berühmten Triller am Schluss der Arietta spielen konnte: sehr langsam, gar nicht „virtuos“, aber von einer Innigkeit, die wie von einem anderen Stern war. Es klang wie ein langer Ton einer menschlichen Stimme, und ich glaube, genau darum geht es: diese Musik ist Ausdruck tiefsten menschlichen Gefühls, und braucht eine zutiefst menschliche Stimme.
ONETZ: Angesichts der chronologisch durchnummerierten Vorgabe - wie viel Freiheit haben Sie sich bei der Zusammenstellung der einzelnen Amberger Konzerte genommen?
Ich habe im Großen und Ganzen versucht, den unglaublichen Entwicklungsbogen der Sonaten nachzuzeichnen, aber auch die berühmten Sonaten gut auf die einzelnen Konzerte zu verteilen. Es gibt ja mit der Waldsteinsonate, der Appassionata, und der Les Adieux Sonate drei ungemein populäre Werke quasi nebeneinander. Dies habe ich versucht zu entzerren, und spiele gleich an den ersten beiden Abenden zwei davon. Was gut passt, denn die allererste Sonate von Beethoven op.2,1 ist ja schon allein durch die gleiche Tonart und ähnlich starke Dramatik eine frühe „Appassionata“. Und im zweiten Konzert wird man sehen, wie weit Beethoven in seiner frühen, unglaublichen Sonate op.10,3 seinen Speer in die Zukunft geschleudert hat. Das braucht ein Gegengewicht mit der „Waldsteinsonate“. Ansonsten habe ich versucht, die Sonaten mit der gleichen Opuszahl nicht zu trennen. Das sind ja Geschwister.
ONETZ: Finden sich unter den 32 Sonaten ein besonderer Liebling und ein besonderer Brocken?
Lieb sind mir wirklich alle Werke. Natürlich gibt es Sonaten, zu denen ich eine besondere Beziehung habe. Mit der F-Dur Sonate op.10,2 oder der Sonate op.31,1 gibt es Werke, mit denen ich mich schon seit einem Vierteljahrhundert auseinandersetze,
nachdem ich diese in meiner frühen Jugend für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ einstudiert habe. Da hängen wirklich viele Erinnerungen dran und es ist interessant zu sehen, wie sich Interpretation über die Jahre ändert. Wie ein Spiegel der eigenen Entwicklung reflektieren diese Werke am meisten von der Persönlichkeit des Spielers. Das macht diese Werke für uns so interessant und lebendig, und deswegen ist es uns auch irgendwie egal, wieviele Male diese Werke von anderen Pianisten schon aufgeführt wurden. Für uns ist das immer ein Abenteuer. Zurück zu der Frage: Ein großer Brocken ist die Waldsteinsonate, einfach weil sich die Idee Beethovens in diesem Werk so schwer darstellen lässt. Das hat eine unglaubliche Abstraktion und Sinnlichkeit zugleich. Und dann natürlich die „Hammerklaviersonate“ op.106, ein Monstrum, das kaum zu fassen ist in der Tiefe des langsamen Satzes und der explodierenden Fuge am Schluss.
ONETZ: Ihre Auftritte im Stadttheater finden eher ungewöhnlicherweise immer sonntags um 17 Uhr statt. Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Nun ja, diese Zeit hat den Vorteil, dass man um 20.15 schon wieder daheim den „Tatort“ schauen kann. Im Ernst: So genau weiß ich es nicht. Aber beim Schubert-Janacek Zyklus hat es gut funktioniert, und so soll es diesmal auch sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Wiedersehen mit dem Amberger Publikum und der schönen Atmosphäre im Stadttheater. Dieser intime Rahmen hat mich immer sehr inspiriert, und das ist bei einem so groß angelegten Zyklus ungemein wichtig.
ONETZ: Sie sind ja auch ein begeisterter Kammermusiker. Wie schnell ist der Schalter umgelegt vom Solisten zum Kollegen?
Der Schalter ist schnell umgelegt, da habe ich mittlerweile genügend Erfahrung. Bei der Kammermusik finde ich die lebendige Kommunikation auf der Bühne so erfrischend: offen zu bleiben und auf etwas zu reagieren, was meine Partner im Konzert machen. Wenn ich wieder allein auf der Bühne bin, brauche ich dann aber umso mehr ein aufmerksames und stilles Publikum: im Idealfall ersetzt das Publikum einen musikalischen Partner und kreiert die Energie, aus der dann ein besonderer Moment entstehen kann.
ONETZ: Was ist eigentlich aus Ihrer Geige geworden, die Sie ja auch zehn Jahre lang gespielt haben?
Meine Geige liegt in ihrem Kasten und das schon seit 20 Jahren. Ich bereue es sehr, früher nicht mit Kollegen ab und zu zum Spaß Streichquartette gespielt zu haben. Dann wäre mir meine Fähigkeiten auf diesem Instrument nicht so dramatisch abhandengekommen, und ich hätte diese wunderbare Musik spielend erfahren können. Jetzt müsste ich richtig viel arbeiten, um überhaupt wieder einigermaßen spielen zu können, und dazu reicht die Zeit leider nicht...
ONETZ: Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie viele renommierte Wettbewerbe gewonnen, 2017 saßen Sie nun in der Jury des berühmten ARD-Musikwettbewerbs – wie sehr können Sie sich noch in die Situation der Kandidaten hineinversetzen?
Ich kann mich noch bestens an meine Wettbewerbe erinnern, die Spannung, dieses etwas seltsam anmutende Wettbewerbsgefühl. Man ist ja da wie in einem Tunnel und merkt Gottseidank nicht, was man sich da antut. Ich habe als Juror versucht, die musikalisch überzeugendste Leistung zu honorieren und mich nicht zu sehr um technische Fehler zu kümmern.
ONETZ: Worauf legen Sie den Schwerpunkt in der Beurteilung der jungen Kolleginnen und Kollegen?
Ich habe mich nach jedem Kandidaten gefragt: Will ich diesen Musiker, diese Musikerin noch einmal hören? Einen ganzen Abend lang? Eine ganz einfache Frage, und nach einem 45-minütigen Vortrag konnte ich diese Frage immer sehr klar für mich beantworten. Ganz unabhängig von meinem persönlichen Geschmack. Den versuche ich aber auch an der Garderobe abzugeben, wenn ich in Konzerte von Kollegen gehe.
ONETZ: Als gefragter Künstler sind Sie sehr viel unterwegs – worauf freuen Sie sich beim Nachhausekommen am meisten?
Wenn ich allein unterwegs bin: Auf meine wunderbare Frau. Wenn wir gemeinsam reisen, was oft vorkommt, da wir ja auch gemeinsam als Klavierduo spielen: Auf den Garten im Sommer und den Kamin im Winter.
Der achtteilige Beethoven-Klavierzyklus mit Herbert Schuch im Stadttheater Amberg startet am Sonntag, 27. Januar 2019, weitere Termine sind Sonntag, 17. März 2019, Sonntag, 12. Mai 2019, Sonntag, 20. Oktober 2019, Sonntag, 24. November 2019, Sonntag, 12. Januar 2020, Sonntag, 8. März 2020 und Sonntag, 24. April 2020. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Gesamtes Abonnement und Karten bei der Tourist-Information Amberg, Hallplatz 2, Tel. 09621/101233, tourismus[at]amberg[dot]de oder im Internet unter www.eventim.de.
Herbert Schuch wurde 1979 in Temeschburg/Rumänien geboren und übersiedelte 1988 mit seiner Familie nach Deutschland. Der dreimalige Bundessieger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ studierte bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling am Salzburger Mozarteum und gewann unter anderem innerhalb eines Jahres den Casagrande-Wettbewerb, die London International Piano Competition und den internationalen Beethovenwettbewerb Wien. 2013 erhielt er den ECHO Klassik für seine Aufnahme des Klavierkonzert von Viktor Ullmann und Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 mit dem WDR-Sinfonieorchester unter Olari Elts. Herbert Schuch ist gefragter Solist, regelmäßiger Gast auf renommierten internationalen Bühnen und bei namhaften Festspielen, aber auch als Klavierduo mit seiner Frau Gülru Ensari oder als Kammermusiker mit Julia Fischer und Daniel Müller-Schott auf Tour. Zudem engagiert er sich in der vom Kollegen Lars Vogt gegründeten Organisation „Rhapsody in School“.
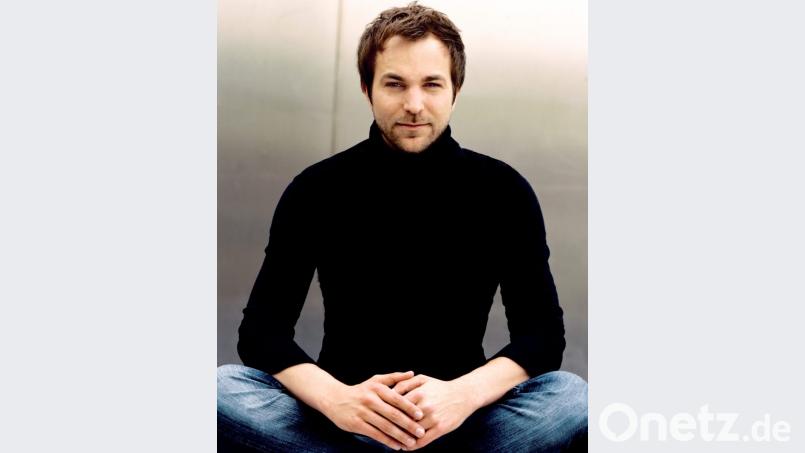














Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.