Wer sich im Internet auf die Suche macht, um etwas über die mediale Darstellung von Frauen zu erfahren, der landet zahlreiche Treffer. Uns besonders aufgefallen ist zum Beispiel ein aus dem Jahr 2016 stammender Beitrag in "fluter", dem Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).
Schon der Einstieg von Autorin Natascha Roshani lässt einen erneut grübeln: "Bei dem Wort ,Mutti' denken wohl die meisten nicht unbedingt an eine politisch einflussreiche Frau. Und doch wird die Bundeskanzlerin, die mächtigste Frau Deutschlands, in der Berichterstattung immer wieder ,Mutti' genannt. Kann das wirklich nur als positives Markenzeichen zu verstehen sein, wie das Magazin ,Cicero' meint?"
Die Geschlechterbilder
Wissenschaftlerinnen von der Freien Universität Berlin und der Leuphana-Universität Lüneburg hatten sechs Monate lang 23 Medien im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung analysiert. Ergebnis: Die mediale Darstellung von Frauen habe System. Weibliche Führungskräfte würden in den untersuchten Medien als "Femme fatale" oder "listige Witwe" tituliert - im besten Fall noch als "Powerfrau". Das männliche Pendant dagegen sei ein "Alphatier", ein "Leitwolf" oder ein "Managerdenkmal".
Dazu heißt es in dem bpb-Beitrag: "Schon diese Formulierungen machen deutlich, wie anders die Geschlechterbilder in Tageszeitungen, Zeitschriften oder Fernsehsendungen ausfallen. Und das, obwohl es sich bei den untersuchten Personen in beiden Fällen um Frauen und Männer in Spitzenpositionen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft handelte." Frauen kämen in den Medien zudem viel seltener vor als Männer - nicht einmal jede fünfte Person sei weiblich. Betrachte man die Berichterstattung im Bereich der Wirtschaft, seien es sogar noch weniger - insgesamt nur fünf Prozent. In der Wissenschaft spielten immerhin zwölf Prozent Frauen eine Rolle. Wie sagte doch Kollegin Christine Ascherl: Fast nur Männer im Blatt. Und dem ist tatsächlich so. Auch in unserer Zeitung. Meistens.
Der Merkel-Faktor
Nur in der Politik seien es auffällig mehr Frauen - nämlich 20 Prozent, so berichtet Natascha Roshani weiter. Dass der Anteil der Nennung von Spitzenpolitikerinnen sogar 30 Prozent beträgt, sei dem sogenannten Merkel-Faktor zu verdanken. Denn die Kanzlerin sei die meisterwähnte Person in allen ausgewählten Medien - von Tageszeitungen wie "Bild" oder "Süddeutsche Zeitung" bis hin zu Wochenmagazinen wie "Stern" oder "Spiegel". Durch ihre Omnipräsenz tue Angela Merkel also durchaus etwas für die Gleichberechtigung: "Aufgrund ihrer Kanzlerschaft treten Frauen in den Medien verstärkt in Erscheinung und werden dadurch anders wahrgenommen."
Ebenfalls vor knapp drei Jahren hat sich Martina Thiele, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg, mit den Geschlechter-Stereotypen in den Medien befasst. Nachzulesen ist das auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung.
Dort heißt es unter anderem: "Wie Frauen und Männer in den Medien präsentiert werden, ist erst seit einigen Jahrzehnten von wissenschaftlichem Interesse. Bis in die 1970er Jahre dominierten Männer die Medien und die Berichterstattung. Erst im Zuge der Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre und aufgrund von Medieninhaltsanalysen, die die Unterrepräsentanz und Stereotypisierung von Frauen belegten, kam die Forderung nach quantitativen und qualitativen Veränderungen auf: Frauen sollten erstens häufiger in den Medien vorkommen und zweitens differenzierter dargestellt werden. Um das zu erreichen, schien es sinnvoll, den Anteil der Journalistinnen in den Redaktionen zu erhöhen. Doch stieg dieser nur langsam, und ein Zusammenhang zwischen Journalistinnen-Anteil und geschlechtergerechter Berichterstattung konnte nur bedingt nachgewiesen werden."
Männer medial präsenter
Bis heute, so Thiele, bestätigten Studien ein Missverhältnis in der medialen Geschlechterdarstellung, das sich nicht allein durch eine ungleiche gesellschaftliche Aufgaben- und Machtverteilung erklären lasse. Nach wie vor seien Männer medial präsenter und kämen deutlich häufiger zu Wort als Frauen. Stereotype Geschlechterbilder sowohl von Frauen als auch von Männern seien weiterhin in allen journalistischen Gattungen und mehr noch in der Werbung zu finden.
Nicht überraschend
Die Geschlechterbilder in den Medien hätten sich inzwischen zwar verändert. Sie seien auf den ersten Blick zahlreicher geworden, auf den zweiten Blick aber nicht unbedingt weniger stereotyp. Denn Präsenz und auch Vielfalt bedeuteten nicht automatisch weniger Geschlechter-Stereotypisierungen und mehr Akzeptanz, betont Thiele. Ansonsten müsste, so die feministische Performance-Künstlerin Peggy Phelan, die Macht in den Gesellschaften des hochindustrialisierten Nordens primär in den Händen junger, weißer, halbnackter Frauen liegen. Doch ihre visuelle Allgegenwärtigkeit habe ihnen wohl kaum politische oder ökonomische Macht verliehen.
Von einem "Ungleichgewicht in Zahlen" spricht in der jüngsten seiner regelmäßig erscheinenden Kolumnen auch Anton Sahlender, Vorsitzender der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO) und seit vielen Jahren Leseranwalt der Main-Post (Würzburg). Diese, so hatte eine Leserin kritisiert und genau belegt, widme ihre Aufmerksamkeit in erster Linie männlichen Personen. Sahlender zweifelte nicht an den Zahlen, "weil sie nicht wirklich überraschen". Denn sie seien "ein Abbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit". Im aktuellen Zeitgeschehen und bei öffentlichen Ereignissen, denen tagesaktuelle Medien besonders verpflichtet sind, böten sich den Journalisten noch nicht übertrieben viel mehr Möglichkeiten zu einer Berichterstattung mit Frauen im Vordergrund. Denn zu viele Organisationen seien "m"-dominiert.
Dessen ungeachtet, so Sahlenders Gedankengang, könnten Redaktionen sich aber das gesellschaftliche Defizit bewusst machen und in Beiträgen darauf hinweisen. Das geschehe vielleicht noch zu selten. Redakteure könnten sich bemühen, so oft es denn möglich und sinnvoll ist, Frauen zu Wort kommen zu lassen.
Mit ein Grund dafür, dass die politische Berichterstattung in unserer Zeitung männerdominiert ist: Es gibt nur wenige 1. Bürgermeisterinnen in unserem Verbreitungsgebiet. Im Landkreis Amberg-Sulzbach (27 Gemeinden) sind es zwei, im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab (38 Gemeinden) vier, im Landkreis Schwandorf (33 Gemeinden) ebenfalls vier, und im Landkreis Tirschenreuth (26 Gemeinden) steht eine Frau an der Spitze.
Mit durchschnittlich 28 Prozent liegt die Präsenz von Frauen in deutschen Nachrichten weit unter den 50 Prozent, die ihnen als Hälfte der Bevölkerung zukommen könnten. Das ist das Ergebnis der weltweiten Medienbeobachtung GMMP (Global Media Monitoring Project) aus dem Jahr 2015, soweit sie Deutschland betrifft.
Infos dazu hat der Journalistinnenbund mit Sitz in Köln veröffentlicht, das Netzwerk von Frauen im Journalismus. Er schreibt: „Das GMMP (Global Media Monitoring Project) richtet sich ausschließlich auf Nachrichten als mediales Genre. Die Beteiligung von Frauen an den Nachrichten (...) scheint signifikant erhöht, von 21 Prozent im Jahr 2010 auf 33 Prozent in den klassischen Medien im Jahr 2015. In Online- und Twitter-Nachrichten wurden 24 Prozent Frauen gezählt. Der Durchschnitt beträgt 28 Prozent.“
Nicht die Zahl der Frauen als Gegenstand der Nachrichten, als Menschen, die zitiert wurden, sei so deutlich gestiegen, sondern die Zahl der Redakteurinnen im TV-Nachrichtenstudio (50 Prozent) und der Fernsehreporterinnen (46 Prozent). „Die Zahl der Nachrichtensprecherinnen lag im Rundfunk mit 79 Prozent sehr hoch, was eher ein Zufallsergebnis ist.“
Im Print-Bereich müsse man allerdings auch heutzutage von einer Geschlechterkluft sprechen: „69 Prozent der Reporter waren männlich, 31 Prozent Frauen. In den Tageszeitungen scheinen die politischen Nachrichten noch immer eine Männer-Domäne zu sein.“
Das GMMP erhebt seit 1995 in fünfjährigem Abstand die Zahl der Frauen (und Männer), die in Nachrichten zu sehen oder zu hören sind und von denen zu lesen ist.










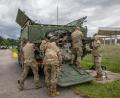









Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.