Die Kritik, dass manchmal zu schnell operiert und zu wenig mit dem Patienten geredet wird, teilt Privatdozent Dr. med. Franz Köck: "Getrieben von den Kostenträgern wurde die konservative Orthopädie geschwächt", sagt der Neutraublinger Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. "Unter Ulla Schmidt ging es mit der Budgetierung los." Dabei zeigen internationale Studien, dass Operationen nicht immer die beste Lösung sind.
Schulterengpass-Syndrom
Der englische Orthopäde Andrew Carraus Oxfordkonnte in einer Versuchsanordnung beim Schulterengpass-Syndrom keinen wesentlichen Unterschied im Genesungsverlauf zwischen arthroskopischer Knochenspornabtragung und suggerierter Schein-OP feststellen, bei der die Patienten nur einen kleinen Hautschnitt bekamen. Anders die Situation beim frischen Sehnenriss an der Schulter: Hier profitieren langfristig operativ versorgte Patienten.
"Das Grundprinzip bei uns ist", erläutert Professor Dr. med. Robert Bauer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im Klinikum St. Marien in Amberg, "ehrlich darüber aufzuklären, welche Erfolgsaussichten eine OP hat und welche Alternativen es gibt." Bei einem Engpassyndrom versuche man es zunächst mit Krankengymnastik und Spritzen, um den Entzündungszustand zu lindern. "Erst wenn das ausgeschöpft ist, sollte man über eine OP sprechen." Man müsse sich aber auch im Klaren sein, in manchen Fällen Schmerzen nur lindern zu können. "Ein 80-Jähriger mit schwerem Verschleiß hat durch die Reparatur keine neue Schulter."
Zweitdiagnose
In seinem Buch "Muskoloskelettale Schmerzen" beschreibt Marcus Schiltenwolf, Professor an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie den Uniklinikums Heidelberg, dass bei Zweitdiagnosen aufgrund nicht ausgeschöpfter konservativer Behandlung beim Knie Zweitgutachter in 80 Prozent von einer OP abrieten, bei der Wirbelsäule in 90 und bei der Schulter in 92 Prozent.
Auch im Klinikum St. Marien wollen sich Patienten nach einer Erstdiagnose noch einmal absichern: "Etwa 10 Prozent der Patienten kommen, um eine Zweitmeinung einzuholen", sagt Professor Bauer. "Sie werden vom Facharzt zugewiesen." Man bespreche mit dem Patienten die Befunde. Wie fortgeschritten sei der Verschleiß? Gab es schon Einspritzungen, kann man noch bestrahlen? "Wir können nur sagen, wie das vom Röntgenbild her aussieht." Kniearthrosen
Eine Studie des US-Orthopäden Bruce Moseleymit 180 Frauen und Männern mit mittelschweren Kniearthrosen verglich Ergebnisse von drei Gruppen: Bei einer wurde gespült und geglättet, bei einer zweiten nur gespült und bei einer Placebo-Gruppe nur die Haut geritzt. Nach zwei Jahren gaben alle Patienten an, weniger Schmerzen zu spüren - unabhängig von der Behandlungsweise.
"Der Spüleffekt ist irgendwann erschöpft", sagt Franz Köck. "Er wirkt bis zu einem gewissen Grad entzündungshemmend." Ist aber nur ein begrenzter Effekt spürbar, sei der Patient eben auch nicht zufrieden.
Angehende Chirurgen sollten verpflichtend bei niedergelassenen Orthopäden hospitieren.
Knorpel und Meniskus
Darauf reagierte 2015 auch der Gemeinsame Bundesausschuss(GBA): Für arthroskopische Verfahren bei Kniegelenkarthrose könne "im Vergleich zu Scheinoperationen oder einer Nichtbehandlung kein Nutzenbeleg gefunden werden". Dennoch sank die Zahl der Arthroskopien nicht - als Grund wurde nun anstelle von Knorpelverschleiß Meniskusverschleiß angegeben.
"Auch bei Meniskusmaßnahmen muss man sparsam umgehen und die Indikation zur OP sorgsam überprüfen", sagt Köck. "Gerade aber notwendige OPs, die nur ambulant durchgeführt werden dürfen, sind extrem unterfinanziert", widerspricht der Orthopäde. "Das ist beim Kassenpatienten für den Operateur häufig nicht mehr als ein teures Hobby."
Wirbelversteifung
Zahlen der Barmerlegen nahe, dass man gelegentlich bei Wirbelsäulen-Operationen aus rein wirtschaftlichen Überlegungen zwischen der Entnahme eines Stückchens der Bandscheibe und der Wirbelversteifung eine Frist von 30 Tagen verstreichen lasse, um gesondert abrechnen zu können (OP 1: 4000, OP 2: 8300 bis 14.200 Euro) - selbst bei technisch einwandfreier Ausführung linderten diese OPs den Schmerz der Patienten nicht, deren Ursache oft verkümmerte Muskeln, Verspannungen und Überlastungen seien. "Wenn ein Operateur aus wirtschaftlichen Interessen eine OP in zwei Teile aufteilt, ist das in meinen Augen ein nicht ethisches Handeln", schließt Professor Bauer dieses Vorgehen in Amberg aus. "Wir operieren nur Wirbelsäulen-Verletzungen."
Das Vergütungssystem drängt die konservative Therapie zurück.
Was raten die Experten?
"Wir müssen in der Ausbildung das Bewusstsein für die Vorteile der konservativen Therapie schärfen", fordert Köck, Dozent für das Fach Orthopädie an der Uni Regensburg. "Auch angehende Chirurgen sollten verpflichtend in der Praxis bei niedergelassenen Orthopäden hospitieren." In den Kliniken spiele die konservative Behandlung von Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen fast keine Rolle mehr. Mit der geänderten Weiterbildungsordnung würde der Schwerpunkt einseitig auf chirurgische Lehrinhalte gelegt.
"In vielen Fällen ist und bleibt aber ein operativer Eingriff die einzig sinnvolle und schmerzbefreienden Option", betont Köck. Daher brauche man nach wie vor engagierten chirurgischen Nachwuchs, der schon jetzt fehle: "Wenn die Fachkompetenz verloren geht, woher soll dann die Expertise kommen?" Die Endoprothetik sei zudem ein anstrengendes Handwerk. Man könne Anreize setzen und den Medizinertest überdenken: Ein 1,0-Abi sagt nichts über handwerkliches Talent und Empathie aus - die werden nicht getestet."
"Das Vergütungssystem drängt die konservative Therapie zurück", kritisiert Bauer. "Ein konservativ behandelter Patient im Krankenhaus ist für die Kasse eine Fehlbelegung." Dadurch werde das System immer OP-lastiger. "Bei uns steht der Patient im Mittelpunkt", versichert der Amberger Professor. "Wir selbst dürfen nicht konservativ behandeln", aber man schicke den Patienten zurück zum Facharzt, wenn das noch nicht ausgereizt sei.


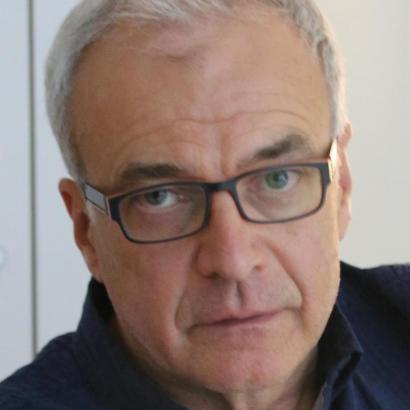













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.