"Was sagen Sie dazu?", fragte mich in meiner Funktion als Leseranwalt von Oberpfalz-Medien der Anrufer, der sich einen Tag nach Erscheinen des Beitrags meldete. Ich antwortete, dass ich den Kommentar der Kollegin völlig okay finde und wies unter anderem darauf hin, dass in ihm ausschließlich die Meinung der Verfasserin wiedergegeben werde, weder die der Redaktion noch des Verlags, so, wie es das Wesen eines Kommentars ist.
Dieser dürfe zum Beispiel auch einseitig sein. Ebenso sei es legitim, provokant zu formulieren, zu überspitzen. Wenn Journalisten einen Kommentar schreiben, wünschen sie sich, dass sich die Leser mit den im Text enthaltenen Ansichten auseinandersetzen. Sie können sie teilen oder ablehnen - aber sie sollten vor allem eines: sich eine eigene Meinung bilden.
Dient der Meinungsbildung
Ein Kommentar, der den Standpunkt des einzelnen Journalisten verdeutlicht, ist eines der wichtigsten Instrumente der täglichen Arbeit einer Redaktion. Er ergänzt ein Thema um die Gedanken und Eindrücke des Autors und will, wie bereits erwähnt, zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Damit trägt ein Kommentar zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Meinungsbeiträge in den Medien sind übrigens durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. In ihm heißt es unter anderem: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten ...".
Der Leser, der den Kommentar von Christine Ascherl kritisierte, vertrat nun beispielsweise die Auffassung, die Autorin gehe zu milde mit der Kirche und ihren Verfehlungen um. Unter der Überschrift "Bei aller Kritik die Kirche im Dorf lassen" hatte die Kollegin in den letzten beiden Absätzen geschrieben: ",Kirchen-Bashing' ist unangebracht, auch wenn es offenbar dem Zeitgeist entspricht, jeder Institution jede Redlichkeit abzusprechen. Heute der Kirche, morgen der Polizei, übermorgen den Medien und nächste Woche der Autoindustrie. Tatsache ist: Aktuell wird es für Verdächtige sehr ungemütlich. Kritik mag angebracht sein, was die Vergangenheitsbewältigung angeht. Verbrechen und ihre Vertuschung, teils vor Jahrzehnten begangen, bleiben eine nicht schließbare Wunde."
In meinen Augen hat Redakteurin Christine Ascherl couragiert und eindeutig Position bezogen. Sie hat davor gewarnt, immer nur auf die Kirche draufzuhauen. In Schutz genommen hat sie die Institution Kirche dabei keinesfalls.
Akzeptieren und tolerieren
Die Autorin habe sich viel zu sehr auf die Seite der Kirche geschlagen, so interpretierte es hingegen der Leser. Vergleiche mit Attacken gegen Polizei oder Medien hielt er angesichts der Dimension von sexuellem Missbrauch für unangebracht. Dass er es so sieht - völlig in Ordnung. Bleibt dem Leser unbenommen.
Doch ist es richtig, einen Kommentar als schlecht oder falsch einzustufen, weil er nicht mit den eigenen Erwartungen und Vorstellungen in Einklang zu bringen ist?
Es gibt drei Arten von Kommentaren
Der inzwischen verstorbene deutsche Journalismus-Lehrer Walther von La Roche unterscheidet drei Arten von Kommentaren: den Argumentations-Kommentar, den Geradeheraus-Kommentar und den Einerseits-andererseits-Kommentar.
Der Argumentations-Kommentar möchte den Leser durch Gründe überzeugen und ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er sich mit anderen relevanten Standpunkten auseinandersetzt. Der Geradeheraus-Kommentar verzichtet, wie der Name schon sagt, je nach Anlass, Thema und Temperament des Autors auch mal auf das Argumentieren. In ihm kann begeistert gelobt oder verärgert geschimpft werden. Der Einerseits-andererseits-Kommentar wägt die verschiedenen Alternativen ab, stellt die Vielschichtigkeit der zu beurteilenden Sache in den Vordergrund und verzichtet – zumindest – vorläufig darauf, sich für eine Alternative zu entscheiden.
Offen mit anderen Meinungen umgehen
Man müsse „Meinungen ertragen lernen“, schreibt mein Leseranwalts-Kollege Anton Sahlender in seiner neuesten Kolumne für die Würzburger „Main-Post“. Er bezieht das jedoch nicht auf Kommentare, sondern auf Leserbriefe. Sahlender ist Vorsitzender der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), ein Verein, in dem sich Leseranwälte zusammengeschlossen haben und regelmäßig austauschen. Oberpfalz-Medien ist ebenfalls VDMO-Mitglied.
Es ist wie in unserer Zeitung auch: Zuweilen erscheinen Leserbriefe, die, wie Sahlender feststellt, „manchen Lesern nicht gefallen, weil sie die darin vertretene Meinung ablehnen, ja weil sie die für ,einseitig bis radikal‘ (so ein Kritiker) halten“. Sahlender weist darauf hin, dass es rechtliche oder ethische Gründe geben könne, die gegen die Veröffentlichung eines Leserbriefes sprechen. „Das wäre der Fall, wenn eine Grenzüberschreitung (wie falsche Fakten, extreme, also grundgesetzwidrige Passagen, Hetze usw.) erkannt wird.“ Gibt es diese Gründe nicht, ist ein Abdruck möglich, wobei kein grundsätzlicher Anspruch darauf besteht.
„Offener Umgang mit anderen Meinungen ist eine ernsthafte Angelegenheit. Radikale (politisch-ideologische von weit abseits der Mitte) Zuschriften können in einzelnen Fällen als schmerzhaft empfunden werden. Das sollte man aber hinnehmen“, schreibt Sahlender. Dies sei dem Grundsatz geschuldet, dass eine Redaktion nicht nur Ansichten veröffentlicht, welche sie selbst teilt. Das gehöre zur Überparteilichkeit. „Und auf die achten gerade kritische Zeitgenossen.“
Auch Meinungen vom Rand der Gesellschaft dürften nicht verborgen bleiben. „Gerade den Menschen, die Medien nutzen, kann man genug Kompetenz zutrauen, um alle Leserbriefe (die grundsätzlich Meinung darstellen) einordnen zu können“, betont Sahlender. Darüber könne sich ihre Medienkompetenz, zu der vor allem der redaktionelle Teil mit Nachrichten und Kommentaren beitragen müsse, nur verbessern. „Dass das funktioniert, darauf sollte man sich in einem Land mit grundgesetzlich garantierter Meinungsfreiheit verlassen können“, hält Sahlender fest. Das heiße allerdings auch: Radikale Ansichten „sollte man kennen und ertragen“. Das versetze einen in die Lage, sachlich begründet zu widersprechen. „Denn das ist notwendig“, meint Sahlender.









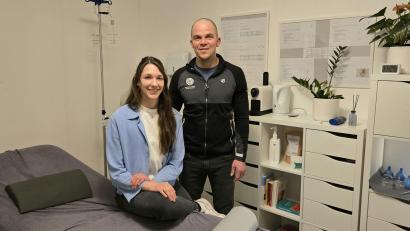




Auch ich habe den Kommentar von Christine Ascherl gelesen und ich gönne natürlich der Autorin ihre Meinung. In der Sache selbst halte ich ihren Kommentar für sehr problematisch, weil er die berechtigte Kritik an den ungeheureren Vorgängen innerhalb der Kirche und deren Aufarbeitung als "Zeitgeist und Kirchen-Bashing' relativiert. Dabei kommt die schärfste Kritik aus der Kirchenspitze: Bereits der ehemalige Papst Benedikt hatte von schwulen „Seilschaften“ im Vatikan gesprochen. Papst Franziskus hat in seiner traditionellen Weihnachtsansprache 2017 "Verräter" in der römischen Kurie kritisiert und "Ehrgeiz und Ruhmessucht" unter den Mitarbeitern angeprangert. Es sei sehr wichtig, eine "unausgeglichene und degenerierte Logik der Komplotte und der kleinen Gruppen" zu überwinden, "die in Wirklichkeit ein Krebsgeschwür darstellen, das zur Selbstbezogenheit führt", sagte der 81 Jahre alte Papst. Nicht jeder Kritiker der Kirche spricht dieser deshalb auch „reflexartig jede Redlichkeit“ ab, wie Ascherl meint! Gerade dieses unterwürfige Verhalten von Presse, Staat und Justiz und die Tradition des Wegsehens und Schweigens, auf Kosten der Opfer, begünstigten, oder ermöglichten erst Missbrauchsfälle dieses Ausmaßes. Es geht auch anders: Die Justiz in Australien hat Unterlagen beschlagnahmt und Anklagen erhoben.
Kardinal Marx bestätigte letzte Woche, dass die schlimmsten Missbrauchsfälle in die aktuelle Studie gar nicht eingeflossen sind, da die Akten in den Bistümern vernichtet wurden. Papst Franziskus räumte ein, dass weltweit in vielen Fällen Nonnen von Priestern und Bischöfen als „Sexsklavinnen gehalten“ wurden und hierbei auch Kinder gezeugt wurden. Teilweise wurden die Nonnen anschließend zu Abtreibungen gezwungen. Der Papst bestätigte damit weitgehend eine Arte-Doku von 2017, die betroffene Nonnen erstmals persönlich zu Wort kommen läst. Man stelle sich vor, dieser Missbrauch hätte in einem Sportverein oder in einer Schule stattgefunden! Wie wäre dann der Kommentar von Frau Ascherl ausgefallen? Alles Vereins-Bashing und Zeitgeist?
Doch nun ist ja alles gut, die Kirche hat daraus ihre Lehren gezogen, meint Frau Ascherl. Wirklich? Die Täter sind weiter im Dienst der Krche. Am 05.10.2018 war in einem Interview mit Kardinal Gerhard L. Müller zu Untersuchungen gegen Bischöfe und Kardinäle, bei „schwerwiegendere Straftaten gegen die Sitten" zu lesen. Demnach braucht die Kongregation vorab die Erlaubnis des Papstes, so Müller. Müller schlägt vor, die Kongregation sollte zunächst unabhängig ermitteln, "erst am Ende des ganzen Prozesses müsste dann der Heilige Vater informiert werden, um die letzte Entscheidung zu treffen." In Polen hat die katholische Kirche in einem Pakt mit der PIS-Partei durchgesetzt, dass Missbrauchsfälle nicht mehr der staatlichen Justiz untererliegen, sondern als „innerkirchliche Angelegenheit“ betrachtet werden. Die Kirche entscheidet auch 2019 was verfolgt wird, -und was nicht.
Soviel zum Thema „Missbrauchstaten sind von Strafgerichten zu beurteilen“, was Christine Ascherl fälschlicherweise bereits als „Standard“ ansieht.
Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.