Bei der gefühlt hundertsten UN-Klimakonferenz in Madrid läuft alles ab wie bei den neunundneunzig Treffen davor: Industriestaaten wie Deutschland brüsten sich mit ihrer angeblich sehr effektiven Klimaschutz-Agenda, Entwicklungsländer fordern mehr finanzielle Unterstützung für ihre Bemühungen sowie mehr Kompensation für die erlittenen Folgen von Extremwetterlagen - und die Wissenschaftler deuten auf die Uhr, deren Zeiger längst auf Zwei vor Zwölf stehen.
Seit 24 Jahren halten die Vereinten Nationen solche Konferenzen ab. In dieser Zeit gab es durchaus große Durchbrüche, etwa 2015 in Paris, wo verbindliche Klimazielen für alle 195 Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention gesetzt wurden. Einer der Rückschläge war der von US-Präsident Donald Trump verkündete Ausstieg aus eben diesem Klimavertrag .
Am Treffen in Madrid nehmen erneut Delegationen aus rund 200 Ländern der Welt teil. Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes weltbewegenden Erfolg ist allein wegen der schieren Menge von Einzelinteressen, die hier aufeinanderprallen, wohl nicht zu rechnen. Die Erwartungen sollte man aber auch aus dem einfachen Grund dämpfen, dass es für ein globales Unterfangen wie dieses - das Aufhalten der Klimaerwärmung - schlicht und ergreifend keine Blaupause gibt.
Wenn Konfliktparteien etwa über Feuerpausen in einem Krieg oder Optionen in einem Handelsstreit verhandeln, dann wird gepokert und gefeilscht - darauf verstehen sich Politiker überall auf der Welt. Die Natur aber, und darauf weisen Wissenschaftler unermüdlich hin, lässt nicht mit sich verhandeln, kennt kein Entgegenkommen. Und die Politik wird diese Menschheitsaufgabe nicht bewältigen, so lange sie das nicht begriffen hat.

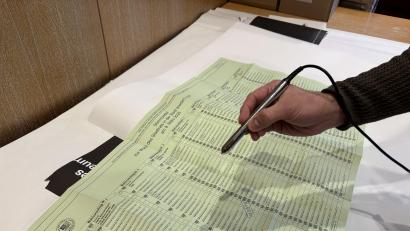












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.