Seit Juni 2018 ist es eine im Stadtrat beschlossene Sache: Regensburg soll eine Stadtbahn bekommen. Anvisiert ist eine Verwirklichung bis 2030. Zwei Nord-Süd-Trassen bilden das Kernnetz: Von Wutzlhofen bis zum Uniklinikum und von der Nordgaustraße bis nach Burgweinting. Auf der insgesamt 14,5 Kilometer langen Kernstrecke soll die Bahn an 35 Haltestellen im 5-Minuten-Takt stoppen. Im innerstädtischen Bereich, in dem sich die zwei Linien überlagern, soll der Takt sogar nur bei zweieinhalb Minuten liegen.
„Unser öffentlicher Personennahverkehr wird urbaner werden“, sagt die Regensburger Planungs- und Baureferentin Christine Schimpfermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Stadtbahn halte so häufig, dass man als Nutzer kaum mehr auf die Uhr schauen müsse. Gewöhnen müssten sich die Passagiere aber auch daran, dass sie auf bestimmten Strecken möglicherweise öfter umsteigen werden. Denn durch die Stadtbahn werde sich auch das Busnetz massiv verändern – derzeit wird noch diskutiert, inwiefern die beiden Verkehrsmittel auf Strecken parallel eingesetzt werden oder nicht. „Das häufige Umsteigen von einem Verkehrsmittel ins andere ist in München ganz normal, das wird hier auch so sein“, sagt Schimpfermann.
Der große Vorteil der Stadtbahn liegt für die Planungsreferentin auf der Hand: In einer Bahn können mit 250 bis 300 Personen wesentlich mehr Menschen transportiert werden als in einem Bus. Außerdem ermögliche die Stadtbahn, die mit Ökostrom betrieben werden soll, ein CO2-neutrales Fahren. Darüber hinaus sei die Stadtbahn durch ihre weitgehend eigene Trasse schneller und zuverlässiger. Weil die Haltestellen rampenförmig erhöht gebaut werden sollen, sei auch ein barrierefreier Zustieg möglich – alles Vorteile gegenüber dem bisherigen Bussystem.
Grundlage für die Entscheidung des Regensburger Stadtrats für die Stadtbahn war eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018. Darin wird die Errichtung der Bahn mit Blick auf die wachsende Einwohnerzahl und den damit nötigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen. Die Studie bescheinigte der Stadtbahn ein positives gesamtwirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis – so dass eine Förderfähigkeit nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu erwarten ist.
Die Förderfähigkeit ist von zentraler Bedeutung – denn die 246 Millionen Euro, die für die Errichtung der Trasse gebraucht werden, könnte die Stadt allein auf keinen Fall stemmen. Wenn das Projekt als förderfähig eingestuft wird, übernimmt der Bund 75 Prozent der Kosten und der Freistaat Bayern nochmal 15 Prozent. „Die 10 Prozent, die dann bei der Stadt bleiben, werden wir uns aus heutiger Sicht leisten können“, sagt Schimpfermann. Auch wenn der in den vergangenen Jahren prall gefüllte Regensburger Stadtsäckel durch einbrechende Gewerbesteuereinnahmen leerer wird, sieht die Planungsreferentin das Großprojekt nicht in Gefahr.
Sie weist aber auch darauf hin, dass es sich um ein Verfahren mit vielen Zwischenschritten handelt, bei dem sich auf dem Weg bis zur Verwirklichung noch einiges ändern kann. Aktuell werden beispielsweise die Brücken entlang der geplanten Trasse auf ihre Stadtbahn-Tauglichkeit überprüft. Die Nibelungenbrücke berücksichtigt eine Stadtbahnführung bereits, bei der Galgenbergbrücke und der Eisernen Brücke muss die Statik noch abgeklopft werden. Wenn hier Probleme auftauchen, könnte sich auch die Trassenführung nochmals verändern, erklärt Schimpfermann.
Diffizil wird die Streckenplanung im engen innerstädtischen Bereich, etwa im Bereich des Dachauplatzes, wo schon jetzt für Autos, Busse, Radfahrer und Fußgänger wenig Platz ist. „Das wird Millimeterarbeit“, kündigt Schimpfermann an. Klar sei bereits, dass der motorisierte Individualverkehr dort deutlich reduziert werden müsse. Außerhalb der Innenstadt gebe es hingegen teils recht großzügige, mehrspurige Fahrbahnen wie in der Landshuter Straße. „Dort sind wir viel freier“, sagt Thomas Feig, Leiter des Amts für Stadtbahnneubau. Ihm schwebt an solchen breiten Stellen ein grünes, auf Rasen gebettetes Gleis für die Straßenbahn vor.
Voraussichtlich im Herbst 2021 soll ein Masterplan stehen, in dem die Trassen und Haltstellen detaillierter festgelegt sind. Dann sollen die Bürger stark mit einbezogen werden. Schimpfermann schweben öffentliche Streckenbegehungen vor, bei denen sich Interessierte ein Bild vor Ort machen können. Auch beim Fahrzeugdesign sollen die Bürger mitsprechen dürfen.
Bislang sind nur einige Eckdaten klar: Die Fahrzeuge werden 2,65 Meter breit und 37 Meter lang sein, beidseitig Türen und Führerstände in beide Richtungen haben. Mitdenken müssen die Planer stets eine mögliche spätere Erweiterung durch zusätzliche Strecken in der Stadt und ins Umland, denn schon vor ihrer eigenen Errichtung ist klar: Die Stadtbahn wird künftig wohl weiterwachsen.
Neues Amt und neuer Ausschuss
Zur Umsetzung des Großprojekts wurde 2019 bei der Stadt Regensburg ein eigenes Amt für Stadtbahnneubau gegründet. Die Planung erfolgt in Kooperation mit der Mobilitäts-Abteilung des Stadtwerks (SMO). Die Stadt ist als Vorhabenträger zuständig für die gesamte Infrastrukturplanung. Die SMO wiederum ist als künftiger Betreiber der Stadtbahn vorgesehen und leistet ihren Beitrag zum Beispiel bei der Planung des Betriebshofs, der Fahrzeugkonzeption sowie bei Liniennetzanpassungen des Busnetzes. Neu ist seit 2019 auch ein eigener Ausschuss zum Neubau einer Stadtbahn im Stadtrat. Fallweise begleitet wird die Planung von einem Expertenbeirat, der derzeit aus vier externen Fachleuten unterschiedlichster Disziplinen besteht.










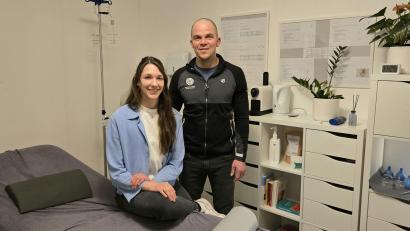








Eine Bahn für Regensburg – das Nachsehen fürs Umland
Jetzt nur nicht neidisch werden: Die Bezirkshauptstadt Regensburg gönnt sich für 246 Millionen Euro eine Stadtbahntrasse – und wir gönnen sie Regensburg. Immerhin will die Stadt 10 Prozent der Kosten selbst stemmen, obendrauf kommen dann noch Kosten für Züge, Betriebsgebäude und Haltestellen-Infrastruktur.
Trotzdem kommt man an der Frage nicht vorbei, wo und wann es denn endlich ein ähnlich ambitioniertes Projekt für das Umland geben wird. In seinem im Mai vorgestellten „Heimatbericht 2019“ lobte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, ein Oberpfälzer immerhin, Bayerns ländlichen Raum als „stark“. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in Stadt und Land bleibe „Daueraufgabe und Kernelement bayerischer Heimatpolitik“, so der Minister.
Was den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeht, ist diese angestrebte Gleichwertigkeit jedoch noch sehr weit entfernt – so weit wie der Mond von der Erde. Oder so weit wie beispielsweise Weiden von Waldthurn, wenn man kein Auto hat. Denn trotz kluger Projekte wie dem „Baxi“, das in mehreren Landkreisen das Busangebot ergänzt, ist eine einigermaßen flexible Mobilität oft unmöglich, sobald man mehr als zehn Kilometer von der nächsten Stadt entfernt wohnt und es nur wenige Busverbindungen pro Tag gibt. Für die kann man sich mit Apps wie „Handyticket Deutschland“ zwar recht bequem eine Fahrkarte per Smartphone kaufen, aber was nützt der Bus nach Weiden um 7, wenn man erst einen Arzttermin um 11 hat?
Nicht nur für manche Senioren wäre ein Ausbau des ÖPNV wichtig, weil sie immer noch Auto fahren müssen, obwohl sie es längst nicht mehr sollten. Auch Familien wären froh, wenn sie nur ein statt zwei Autos bräuchten.
Wo also bleibt es, das Monatsticket für die ganze Oberpfalz?
Frank Stüdemann