„Hier sind Löwen“: So wurden früher unerforschte, vermeintlich gefährliche Stellen auf der Weltkarte bezeichnet. Im gleichnamigen Roman erforscht Helen die armenische Kunst des Buchbindens und taucht zugleich ein in die eigene Familiengeschichte und die bis heute nicht allgemein anerkannte historische Tragödie Armeniens. Am Donnerstag, 8. Oktober ist Katerina Poladjan zusammen mit Nadine Schneider Gast der Gesprächslesung „Weggehen und Ankommen“ im Capitol in Sulzbach-Rosenberg. Was Herkunft für sie bedeutet und wie Erinnerung wirken kann, erzählt die Schriftstellerin schon jetzt im Interview:
ONETZ: Frau Poladjan, Sie wurden in Moskau geboren. Welche Bedeutung messen Sie dem Begriff „Herkunft“ bei?
Katerina Poladjan: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe an so vielen Orten gelebt, musste so oft meine Umgebung wechseln, dass meine Herkunft in mir als emotionaler Ort zwar vorhanden ist, allerdings ist die Frage „woher komme ich“ nur ein möglicher Hallraum für die Frage „was tue ich hier eigentlich“. Unsere Herkunft ist an Zufälligkeiten gebunden und das macht es für mich um so abstrakt.
ONETZ: Mittlerweile leben Sie in Berlin. Angekommen oder nur Zwischenstation?
Katerina Poladjan: Angekommen zumindest in einem Zuhause. Und mit den Menschen, die mir nahe stehen.
ONETZ: Wenn Sie zwischen früher und jetzt vergleichen - verändert sich der Blick auf die eigene Familiengeschichte über die Jahre?
Katerina Poladjan: Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit auch oft gestellt habe. Ich kann nur von mir sprechen, aber meine Perspektive auf meine eigene Familiengeschichte verändert sich mit den Jahren. Mein Blick wird weicher, möglicher Groll leuchtet nicht mehr so grell. Der Blick auf meine Eltern und ihr Leben ist wohlwollender und zärtlicher geworden. Ich verstehe viel mehr, warum sie so oder so gehandelt haben. Wenn man jung ist, sind die Eltern stets an das Kind gekoppelt und mit der Zeit lernt man die Eltern zum Glück als Individuen kennen, die für das Kind nicht stets zur Verfügung stehen müssen.
ONETZ: Für Ihren Roman mussten Sie sich ja auch den realen Schatten der Vergangenheit stellen – ein schmerzhafter oder letztlich doch heilender Prozess?
Katerina Poladjan: Es war ein schmerzlicher Prozess. Ein Prozess bei dem es keine Erlösung im übertragenen Sinne gibt. Ich glaube ich habe mit diesem Roman stellvertretend für meinen Vater die Fragen gestellt, die er seinem Vater nicht gestellt hat.
ONETZ: Welche Rolle spielt die Erinnerung an das Massaker an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich in Ihrer Familie?
Katerina Poladjan: Mein Großvater väterlicherseits hat den Völkermord überlebt. Er wurde von seiner Schwester gerettet. Mein Großvater hat wenig darüber gesprochen. Diese schmerzhafte Lücke wirkt bis heute, bis in die vierte Generation. Mein Vater hat sich in seiner Kunst mit dem Völkermord beschäftigt, allerdings auf eine sehr abstrakte Weise. Das Wesen menschlichen Denkens und Fühlens fußt doch auf der Fähigkeit zur Erinnerung. Wir können ja gar nicht nicht-erinnern, wir können nur leugnen oder vergessen. Erinnerung kann negativ wirken, traumatisch gar, und zum Durst nach Rache und Vergeltung führen. Viel mehr noch ist die Erinnerung eine Säule der Humanität und des Mitgefühls. Und letzteres ist doch Grund genug für die Spurensicherung.
ONETZ: Wie nehmen Sie es wahr, dass der Völkermord an den Armeniern immer noch nicht von allen Staaten beim Namen genannt wird?
Katerina Poladjan: Für die Menschen ist es ein Hohn. Es ist zutiefst zynisch. In Armenien hat mir eine Frau einmal gesagt, du musst dir vorstellen, du erzählst von deiner Familiengeschichte, von den grausamen Verlusten, von Flucht, Mord und Vertreibung und als Antwort bekommst du: Das, was du sagst, ist nicht wahr. Einfach nicht wahr.
ONETZ: Glauben Sie, dass man auch ohne tiefer gehende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ein glückliches Leben führen kann?
Katerina Poladjan: Interessante Frage. Die ich eigentlich nicht beantworten kann, denn wie soll man leben, ohne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, denn nichts anderes hat man doch zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ob man alles bis in die tiefste Ecke ausleuchten muss, aber es hilft sicherlich die Geschichte der Eltern und deren Eltern zu studieren, um ein Stück weit sein eigenes Verhalten besser einordnen zu können. Ob man es dann versteht oder gar steuern und beeinflussen kann, ist eine andere Frage. Aber der Blick sollte stets ein sanfter sein.
Nietzsche hat einmal den Satz geschrieben: „‚Wille zur Wahrheit‘ – das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.“ Und dann wäre da noch die große Frage: Was ist ein glückliches Leben? Dazu gibt es viele hochinteressante philosophische Abhandlungen, die sich der Frage zu nähern versuchen. Am Ende ist wohl auch das eine sehr intime Angelegenheit.
Zu Lesung und Buch
Die Gesprächslesung mit Katerina Poladjan und Schriftstellerkollegin Nadine Schneider findet am Donnerstag, 8. Oktober um 19.30 Uhr im Capitol in Sulzbach-Rosenberg statt. Veranstalter ist das Literaturhaus Oberpfalz, es moderiert Christine Hamel vom Bayerischen Rundfunk. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, keine Abendkasse, Anmeldung zwingend erforderlich unter Tel. 09661/8159590 oder per E-Mail info[at]literaturarchiv[dot]de. Es gelten die üblichen Corona-Regelungen.
Der Roman "Hier sind Löwen", 288 Seiten, gebunden, ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 22 Euro.
Zur Person
Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, lebt seit 1979 in Deutschland, studierte Angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg und Darstellende Kunst in München. Für ihre literarische Arbeit erhielt sie zahlreiche Stipendien, 2015 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb in Klagenfurt teil. "Hier sind Löwen" ist ihr dritter Roman und stand 2019 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2019. Katerina Poladjan lebt in Berlin.

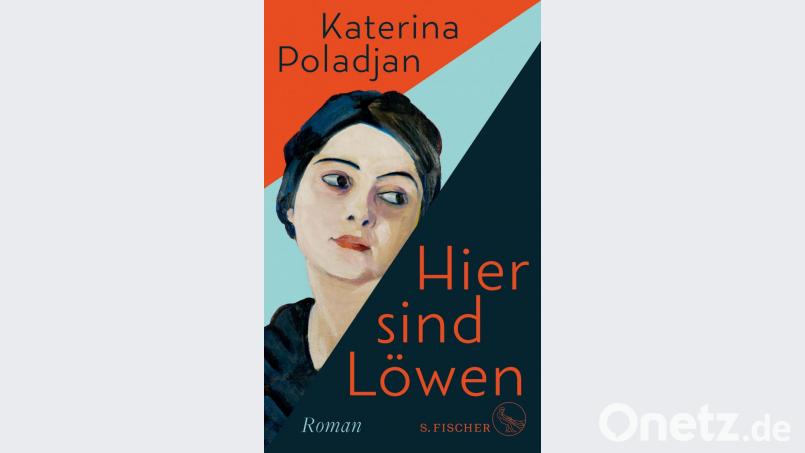













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.