Ein weiterer Fall von unklarer Geschlechteridentität? Das paritätische Duo lacht: "Es ist einfach gut, einen Mann auf unserer Seite zu wissen", erklärt Katja Ertl. "Gleichstellung funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen." Das ungleiche Paar steht der Gruppe von 20 Frauen, die in der nördlichen Oberpfalz die Belange der weiblichen Belegschaft ins öffentliche Bewusstsein rücken wollen, aber keineswegs vor.
"Es gibt keine neue Organisationsform", sagt Hofmann, "wir haben nur ein Netzwerk geschaffen, das 365 Tage im Jahr die strukturelle Benachteiligung von Frauen thematisiert - statt nur am 8. März." An diesem Datum, dem Internationalen Frauentag vor drei Jahren, habe man sich zum ersten Mal getroffen: "Seitdem touren wir mit wachsender Beachtung durch die Unternehmen in der Region." Mit Erfolg: "Wir hatten erst neulich wieder Neuzugänge aus Weiden und Tirschenreuth", freut sich Ertl.
Kindergarten-Streik
Besonders in Branchen mit klassischen Frauenberufen, wo die Bezahlung so schlecht ist wie die gewerkschaftliche Vertretung, wollen die DGBler ihren zarten Damenfuß beinhart reinzwängen. "Bei Pflegeberufen, dem Thema Kindererziehung, aber natürlich auch bei der ganzen Palette der 450-Euro-Jobs", nennt Hofmann die Zielrichtung. Als bundesweit Erzieherinnen in Streik traten, habe man Kolleginnen in den städtischen Burglengenfelder Josefine-Haas- und Louise-Haas-Kindergärten besucht. "Die traten sehr geschlossen auf und haben so bessere Bedingungen rausgehandelt", freut sich Hofmann, "Tausende Frauen sind in der Folge Verdi beigetreten."
Das Spektrum, das nominell die Interessen von rund 51 Prozent der Bevölkerung widerspiegelt, ist breitgefächert, wie Katja Ertl betont: "Wir wollen den gesetzlichen Rahmen verbessern, aber im Kern ist es ein gesellschaftliches Thema, das auch Ehemänner und Familienangehörige betrifft, die unter den schlechten Arbeitsbedingungen der Frau leiden." Zu den Facetten gehören:
◘ Familie und Beruf
"Frauen sind nun mal das Geschlecht, das Kinder bekommt", stellt Ertl lakonisch fest, "deshalb brauchen wir genügend Krippenplätze." Ein riesiges Problem in Regensburg, wie sie einräumt, kaum ein Thema im ländlichen Raum.
◘Babypause und Teilzeitfalle
Die Teilzeitquote bei Vätern liegt gerade mal bei 5,65 Prozent, bei Müttern bei 70 Prozent. Anschließend gelinge es nur wenigen Frauen, in ihre erlernten Berufe zurückzukehren oder gar die Position zu halten. "Von den 10 schlecht bezahltesten Jobs werden 8 von Frauen dominiert", macht Ertl deutlich. Für die Rente hat der Einsatz als Mutter nur Nachteile: "3 Jahre Erziehung sind gedeckt, für die 7 Jahre danach gibt es nur eine Anrechnung ohne finanziellen Ausgleich", kritisiert Hofmann.
◘ Pflege von Angehörigen
Auch hier sind meist Frauen in der Pflicht. "Bei Pflegegrad 2 erwerben sie etwas mehr Rentenanwartschaft als beim 450 Euro-Job", klagt Hofmann, "bei 5c, was zu Hause kaum mehr zu leisten ist, sind es dann gerade mal 30 Euro pro Monat."
◘ Die Rentenlücke
Die Folge der lebenslangen Benachteiligung - 70 Prozent der Rentnerinnen leben unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze von 1074 Euro im Monat, bei Männern nur 37 Prozent. Die Durchschnittsrente der Oberpfälzerinnen beträgt 624 Euro, nach Niederbayern der schlechteste Wert.
◘ Ungleiche Bezahlung:
Im Schnitt verdienen Frauen 24 Prozent weniger als Männer, bei gleicher Tätigkeit immer noch 5 Prozent. Zum einen sind es meistens Frauen, die nach der Babypause zu Hause bleiben und danach häufig nur noch schlecht bezahlte Teilzeitjobs finden. Zum anderen dominieren Frauen oft soziale Berufe, die schlechter bezahlt sind als Tätigkeiten in der Industrie. Bei frei verhandelten Gehältern falle es Frauen oft schwerer, um faire Bezahlung zu streiten: "Deshalb verdienen sie bei nicht tarifgebundenen Tätigkeiten oft weniger für gleiche Arbeit." Eine Forderung der Gewerkschaft: "Ohne Ausgleich für die Erziehungszeit ziehen sich die Probleme bis in die Rente", sagt Hofmann.
◘ Landärztinnen-Mangel
Frau ist am Land auf ärztliche Versorgung angewiesen, kommt aber auch als Dr.-Nachwuchs infrage, wenn die Rahmenbedingungen stimmten: mehr Gemeinschaftspraxen, bessere Infrastruktur, Ausbau des ÖPNV. "Um weitere Landflucht zu vermeiden, braucht es eine Aufwertung des ländlichen Raums", fordert Ertl. Ein Beispiel für medizinische Frauenpower: Dr. Brunhilde Dick-Kollmannsperger, die Praxen in Waldsassen und Mitterteich betreue. "Sie hofft, ihre Tochter übernimmt", erklärt Peter Hofmann.
Aus DGB-Sicht kommt aus der Politik zu wenig Rückenwind: "Zwischen SPD-Programm und Regierungshandeln klafft eine Kluft", outet sich Ertl als Groko-Kritikerin. Und sogar in ihrem eigenen Arbeitsumfeld hat sie das Gefühl, immer mehr leisten zu müssen als männliche Kollegen: "Als junge Frau muss ich mich immer wieder beweisen, vor allem in den Gremien der Kammern."
„Im Freistaat werden nur noch 53 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt“, ärgert sich Verena Di Pasquale, stellvertretende bayerische DGB-Chefin. „Bayern ist Schlusslicht unter westdeutschen Bundesländern.“ Dazu komme: „Das Thema Gleichstellung spielt im Koalitionsvertrag eine untergeordnete Rolle. Der Freistaat ist auch Arbeitgeber, und hat hier Vorbildfunktion“, fordert Di Pasquale.
Interview mit Verena Di Pasquale, stellvertretende bayerische DGB-Chefin, zur Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben.
ONETZ: Sie sagen: Das bayerische Gleichstellungsgesetz sei 22 Jahre alt, aber von Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist man hier noch besonders weit entfernt. Was unterscheidet Bayern von anderen Bundesländern – die Lohnunterschiede legt ja nicht der Ministerpräsident fest?
Verena Di Pasquale: Der Ministerpräsident hat sehr wohl Einfluss. Im Freistaat werden nur noch 53 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt. Bayern ist Schlusslicht unter westdeutschen Bundesländern. Bayern braucht ein Tariftreue- und Vergabegesetz, damit staatliche Aufträge nur noch an die Unternehmen vergeben werden, die mindestens den branchenbezogenen Tariflohn zahlen.
Im Koalitionsvertrag ist von „gleicher Bezahlung für Frauen und Männer die Rede“, aber nicht von guter Bezahlung. Thema Gleichstellung spielt im Koalitionsvertrag eine untergeordnete Rolle. Der Freistaat ist auch Arbeitgeber, und hat hier Vorbildfunktion. Zudem muss er den Gleichstellungsauftrag aus Grundgesetz und Bayerischer Verfassung umsetzen. In den obersten Dienstbehörden des Freistaates liegt der Frauenanteil in Führungspositionen zwischen 10 und 24 Prozent. Daher müssen die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten in Bayern gestärkt werden und unter anderem Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden, jedoch ist im neuen Koalitionsvertrag von einer Novellierung des BayGlG keine Rede.
Der geringe Frauenanteil in Landtag (55 von 205 Abgeordneten) ist ein gleichstellungspolitischer Rückschritt. Ein politisches Mandat braucht Zeit und Geld und ist vor allem eine Frage der Ressourcen. Das trifft vor allem Frauen, die noch immer den Löwenanteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen müssen.
ONETZ: Sie sagen, Frauen verdienten hier 22 Prozent weniger, umgerechnet 6 Prozent weniger für gleiche Arbeit – können Sie das Rausrechnen der Teilzeitaspekte erläutern? Bekommen Teilzeit-Männer tatsächlich mehr oder liegt's eher an den miesen Jobs, die eher Frauen annehmen?
Verena Di Pasquale: Die Differenz ist in Bayern deutlich höher als in fast allen Bundesländern, und liegt bei 24 Prozent. Ausschlaggebend sind strukturelle Faktoren, die Bezahlung in frauendominierten Berufen – z.B. in der Pflege – ist deutlich schlechter. Zudem sind Frauen seltener in gut bezahlten Führungsjobs. Frauen unterbrechen ihre Berufstätigkeit häufiger für Betreuungsarbeit in der Familie. Dadurch ist auch der Frauenanteil an – oftmals unfreiwilliger – atypischer Beschäftigung so hoch. Viele Frauen stecken in der Teilzeitfalle fest.
Die Arbeitszeiten von Frauen und Männern haben sich in den letzten Jahren nur gering verändert. Teilzeit hat sich als Arbeitsform von Müttern weiter manifestiert. Nach wie vor haben Mütter und Väter grundsätzlich andere Arbeitszeitrealitäten. Mütter in Deutschland sind im EU-Vergleich deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt eingebunden als Frauen ohne Kinder, die Arbeitszeiten von Frauen in Deutschland sind die zweitkürzesten.
ONETZ: Inwiefern hat Hartz-IV-Niedriglohn-Arbeit befördert – und wie müsste aus Ihrer Sicht der Ausweg aus der Babypausen-Falle gestaltet werden?
Verena Di Pasquale: Mit Installation des Hartz-IV-Systems wurde der Druck auf Arbeitslose erhöht, Arbeit aufzunehmen. Die Zumutbarkeitskriterien wurden verschärft bis hin zu Leistungskürzungen. Leiharbeit und Minijobs ausgeweitet und somit ein Sog in prekäre Beschäftigung geschaffen. Dies war ausdrückliches Ziel der Agenda 2010 der damaligen Bundesregierung.
Seit 1.12.2018 ist das lange geforderte Recht auf befristete Teilzeit in Kraft, die sogenannte Brückenteilzeit. Damit wird es auch für Männer attraktiver, sich für kürzere Arbeitszeiten und mehr Familienarbeit zu entscheiden. Das Gesetz enthält spürbare Fortschritte, bleibt aber deutlich hinter den gewerkschaftlichen Forderungen zurück. Es gilt nur für Betriebe mit mehr als 45 Beschäftigten, was eine erhebliche Einschränkung darstellt. Die ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit (bezahlte und unbezahlte Arbeit) ist ein zentraler struktureller Grund für die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt.
Das sogenannte Familiengeld (Nachfolger der Herdprämie Betreuungsgeld) wäre besser in den Ausbau von guter und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung investiert. In Bayern fehlen nach wie vor über 50.000 Betreuungsplätze. Zudem gibt es in Bayern bei dieser Leistung zwei konträre Rechtsauffassungen. Nur in den sogenannten Optionskommunen wird das Familiengeld nicht mit den Sozial-leistungen verrechnet. Eine gute Betreuungsstruktur käme auch Alleinerziehenden zugute.
ONETZ: Pflegerinnen, Krankenschwestern, Erzieherinnen hätten immer noch das Image, dass sie einen "mildtätigen Liebesdienst" leisteten, für den Geld zweitrangig sei. Ist es nicht eher so, dass im Gesundheitssektor seit Jahren die Kosten explodieren und es nicht ganz einfach ist, Löhne auf BMW-Niveau zu zahlen?
Verena Di Pasquale: Laut den Daten des statistischen Bundesamtes kann von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen keine Rede sein. Seit Jahren bewegt sich der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt rund um 11 Prozent. Nominal gibt es tatsächlich Kostensteigerungen, die vor allem auf gesetzgeberische Maßnahmen zurückzuführen sind. Beispielhaft aus der jüngsten Vergangenheit sind hier die Pflegestärkungsgesetze zu nennen, welche zum Teil erhebliche Leistungsverbes-serungen vorsehen und damit den Versicherten zugutekommen.
Am Beispiel der Krankenhausfinanzierung lässt sich exemplarisch zeigen, wie Verantwortungen zu Lasten der Beschäftigten abgewälzt werden. Die Bundesländer sind für die Investitionskosten der Krankenhäuser verantwortlich. Ihren Verpflichtungen kommen diese jedoch nur ungenügend nach. So bemängelt die bayerische Krankenhausgesellschaft am aktuellen bayerischen Koalitionsvertrag, dass nach einer jahrelangen Durststrecke bei den Investitionskosten noch nicht einmal das Niveau von vor dreißig Jahren erreicht werde. Krankenhäuser schichten seit Jahren daher notwendige Investitionskosten aus laufenden Einnahmen um. Geld, welches z.B. für eine bessere Personalausstattung und/oder Bezahlung fehlt.
ONETZ: Die Sicht auf Armut hinterlässt ein zwiespältiges Gefühl: Auf der einen Seite sind natürlich nicht wenige Menschen in Bayern von relativer Armut betroffen. Auf der anderen Seite argumentieren gerade die Rechtspopulisten mit dieser Armut, dass sich Deutschland keine Flüchtlinge leisten könne – stellt Flucht vor Klimawandel-Folgen in Afrika oder vor Bürgerkrieg nicht noch eine ganz andere Dimension von Armut dar?
Verena Di Pasquale: Die Stoßrichtung der Rechtspopulisten ist immer gleich. Egal ob beim Thema Armut, der Rente oder wenn es um Wohnraum geht. Dabei ist folgendes festzuhalten. Armut durch zu geringer Regelsätze gab es seit Implementierung des SGB II. Auch die politische Entscheidung beispielsweise das Rentenniveau abzusenken, war unabhängig von dieser Entwicklung. Der vielerorts mangelnde Wohnraum ist das Ergebnis jahrzehntelanger Verfehlungen und nicht eines singulären Ereignisses. Der gesellschaftliche Reichtum, der unzweifelhaft vorhanden ist, wurde weder vor dem vermehrten Ankommen der Flüchtlinge noch danach adäquat genutzt, um Armut zu bekämpfen.
Natürlich geht es im Zusammenhang mit Armut in unserer Gesellschaft nicht um absolute Armut sondern um relative Armut. Ja es stimmt, die deutschen Armen wären vielleicht Krösusse in Kalkutta oder Mogadischu. Aber Armut bezieht sich immer auf die Gesellschaft in der man lebt. Die Armen bei uns sind arm, weil sie aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen sind. Soziale Teilhabe ist mit Hartz IV schlicht nicht möglich.





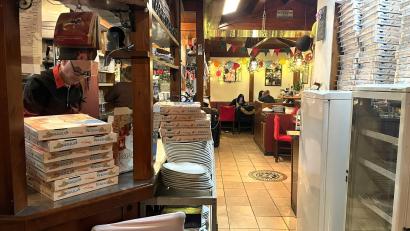










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.