Schon bei ihrer Begrüßung wies Archivdirektorin Maria Rita Sagstetter auf die vielfältigen Aufgaben ihres Hauses hin. Vor Publikum nannte die Leiterin des Staatsarchivs die Ausstellung einen Kraftakt und dankte den Mitarbeitern für das erhöhte Engagement.
Den ersten Vortrag hielt Martin Dallmeier, langjähriger Vorsitzender des Historischen Vereins für Regensburg und die Oberpfalz. Er ist zudem Mitarbeiter im Hause Thurn und Taxis. Sein Thema: "Die kaiserliche thurn und taxissche Reichspost in der Oberpfalz." Er referierte über Entstehung, Strukturen und Ausformung und beschäftigte sich mit der Zeit von 1527 bis 1808.
Anfänge im 15. Jahrhundert
Die Anfänge der Post im heutigen Sinn geht auf den jungen König Maximilian I. zurück. Er ließ 1490 eine neuartige Kommunikationseinrichtung einrichten. Mit der Idee, im Unterschied zum mittelalterlichen Botenwesen, die Botschaft nicht mehr durch einen einzigen Menschen, sondern durch eine Kette von Posten, wie sie genannt wurden, und Postreitern vom Absender zum Empfänger befördern zu lassen. Der lateinische Begriff posita statio bezeichnete ursprünglich jenen Ort auf einer Route, an dem Pferde und oder Reiter bereitgehalten wurden, um Briefe und Nachrichtensendungen zu übernehmen und mit frischen Kräften weiter zu befördern. Die in Italien im Kurierwesen erfahrenen Taxis aus dem Bergdorf Cornello bei Bergamo übernahmen im Jahre 1490 auf königlichen Wunsch hin den Aufbau und Ausbau des neuen Postkursnetzes. Sie hatten bereits seit etwa 50 Jahren Erfahrungen im Boten- beziehungsweise Postwesen der Serenissima in der Republik Venedig und im päpstlichen Postwesen gesammelt. Da dieses neue Kommunikationssystem zunächst nur für die dynastischen und politischen Belange der Habsburger genutzt werden sollte, überzog alsbald ein Kursnetz halb Europa, von Neapel im Süden bis Antwerpen, Brüssel und Mechelen im Nordwesten, oder von Granada in Andalusien im Westen bis nach Wien im Osten, also grob gesprochen: den Machtbereich des deutschen und spanischen Habsburgerreiches. Erst allmählich wurde aus finanziellen Notwendigkeiten dieser delegierte monopolistische Staatsbetrieb für dynastische Kommunikationsbelange des Habsburgerreiches auch für private Postsendungen geöffnet. Die Beförderungsgebühren, also das Franco oder Porto für die Privatbriefe, sollten zunehmend die schwindenden Subventionen der habsburgischen Kaiser und Könige ersetzen.
Im Abstand von 36 Kilometern
Entscheidend für den schnellen erfolgreichen Aufstieg der nun öffentlichen Post war dabei die Erhöhung der Beförderungsgeschwindigkeit durch die Anlage von Relais- oder Poststationen in regelmäßigen Abständen. Zunächst - 1490 - wurden diese im Abstand von etwa 36 Kilometern angelegt, zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde von zwei Meilen (14 bis 15 Kilometer) oder einer Postmeile als gewöhnliche Entfernung zwischen zwei Stationen ausgegangen. Dies war anscheinend jene Distanz, in der die optimale Beförderungsgeschwindigkeit unter Ausnutzung der Ressourcen von Mensch (Reiter) und Tier (Pferd) erreicht werden konnte. Erst mit dem Aufkommen der Eisenbahn seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Quantensprung bei der Beförderungsgeschwindigkeit.
Ära Thurn und Taxis endet
1808 beendete eine Verordnung von König Max I. Joseph das Postregal der Familie Thurn und Taxis. Das Postwesen kam in staatliche Regie. 1920 endete die bayerische Selbständigkeit des Post- und Telegraphenwesens. Das Reichspostministerium beende das sogenannte Reservatsrecht von Bayern.
Till Strobel, ein Mitarbeiter des Staatsarchivs, erklärte in seinem Referat den Aufbau und die Entwicklung der Bestände zur Postgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts im Archiv. Er gab den Anwesenden Tipps zur Benutzung der umfangreichen Bestände zur Postgeschichte. Mitarbeiter Jochen Rösel gab schließlich eine Überblick über den Aufbau der Ausstellung.

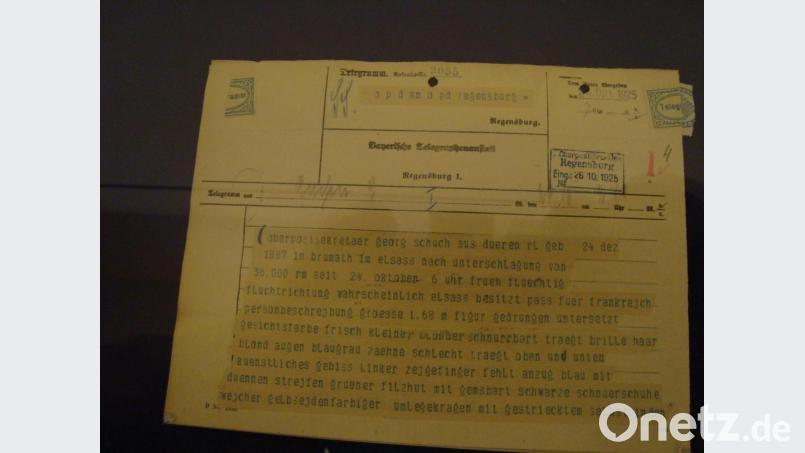














Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.