Es war keine große Überraschung, dass Matthias Wittmann einstimmig (bei einer Enthaltung) zum neuen Vorsitzenden des Maschinenrings Tirschenreuth gewählt wurde. Nicht nur war er der einzige Kandidat, zudem war er der bisherige Stellvertreter von Hans Enslein, der nach 10 Jahren an der Vereinsspitze nicht mehr angetreten war. Zuvor war Enslein auch fünf Jahre als Stellvertretender Vorsitzender und wurde mit einem kelinen Präsent und viel Applauf von der Vesammlung verabschiedet. An der Seite des neuen, Plößberger Vorsitzenden agiert künftig Michael Eichenseher aus Wiesau, der von der Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde.
Die Wahl leitete der Bezirksvorsitzende der Maschinenringe, Franz Roider, der während einer Auszählung in seinen Grußworten viel Lob für den Tirschenreuther Maschinenring überbrachte. "Viel ist hier in der nördlichen Oberpfalz in den vergangenen Jahren entstanden", stellte er anerkennend fest.
Roider nahm damit auch Bezug auf den Geschäftsbericht über die Aktivitäten des Vorjahres. Geschäftsführerin Marion Höcht berichtete, dass über 39.000 Arbeitsstunden in der sozialen und wirtschaftlichen Betriebshilfe geleistet wurden, dies allein entspreche 22 Vollzeitkräften. Zudem sei die überbetriebliche Machinenverwendung die wichtigste Säule des Maschinenringes Tirschenreuth. "Die Teilhabe am technischen Fortschritt für alle Landwirte und die Nutzung von moderner und umweltschonender Technik bleibt für und die Kernaufgabe", sagte Höcht. Der Verrechnungswert von über 8 Millionen Euro im Jahr 2022 spiegele das deutlich wieder. Außerdem war ein hoher Beratungsbedarf bei den Mitgliedern zu verzeichnen, erläuterte die Geschäftsführerin. Themen waren hier neben Düngemitteleinsatz auch regenerative Landwirtschaft sowie die Fördermöglichkeiten mittels der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP). Hier habe sich der Maschinenring mit dem Arbeitstitel "Rückführung der Bodenbiologie mit Hilfe des Johnson-Su-Kompostverfahrerns mit verschiedenen Applikationstechniken" eingebracht.
Besonders stolz war Höcht über die erfolgreiche Rezertifizierung im Bereich Arbeitssicherheit. "Die so genannte OHRIS-Zertifizierung wurde vom Bayerischen Gewerbeaufsichtsamt vergeben", erklärte sie den hohen Stellenwert dieser Qualitätsauszeichnung.
Mit Blick auf die Geschäftszahlen verzeichnete Höcht einen vorläufigen Überschuss in Höhe von rund 12.445 € (2021: 63.107 €). Vorläufig sei der Überschuss deswegen, weil im Laufe des Jahres weitere Förderzusagen für das Vorjahr erwartet werden, die entgültigen Zahlen würden im kommenden Jahr vorgestellt werden. Der noch amtierende Vorsitzende, Hans Enslein, begründete kurz den Überschussrückgang von 2021 zu 2022: "Während der Hochphase der Pandemie fanden keine Veranstaltungen oder Sitzungen statt, da haben wir einiges an Geld sparen können." Im weiteren Verlauf der Versammlung haben die Mitglieder den Haushalt mit einem Volumen von 400.000 € auf der Einnahmen- sowie auf der Ausgabenseite für 2023 verabschiedet. Damit bleibt der Jahreshaushalt auf dem Niveau der Vorjahre.
Abgestimmt haben die Mitglieder auch über die Regelversteuerung der Mitgliedsbeiträge. "Aufgrund eines Urteiles des europäischen Gerichtshofes", führte Höcht durch den Antrag, "werden wir künftig auf den Mitgliedsbeitrag Umsatzsteuer erheben müssen." Für die Mitglieder bedeute dies Mehrkosten in Höhe von 6,65 Euro pro Jahr, was einstimmig angenommen wurde.
Ebenso einstimmig bestätigte die Vollversammlung des Maschinenringes die bereits Ende 2022 vor Ort gewählten Ringobmänner. Diese 32 Delegierten bilden den Gesamtvorstand des Maschinenringes. Bestätigt wurden ebenso einstimmig die beiden bisherigen Kassenprüfer, Hans-Jörg Schön und Markus Gmeiner, in ihrem Amt für die kommende Legislaturperiode.
Im Anschluss an den offiziellen Teil, trug Dr. Michael Mederle vom Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM), dem Dachverband der Maschinenringe, zum Thema "Transformation in der Landwirtschaft" vor. Deutlich zeigte er die Wandlung bei Produktion und Wirtschaftlichkeit von landwirtschaftlichen Betrieben seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf. So ernährte ein Landwirt im Jahr 2020 auf 0,2 Hektar Ackerfläche pro Einwohner durchschnittlich 137 Menschen. Im Vergleich dazu waren es um 1950 10 Menschen mit 0,29 Hektar/Einwohner Fläche.
"Der Ertrag je Fläche wird immer besser", stellte er fest. Beispielsweise habe sich der von Weizen seit 1910 etwa vervierfacht. Das bedeute aber auch, dass die Landwirte stets investieren müssen. "Wandel oder Wegfall lautet das Stichwort", ergänzte Dr. Mederle. Daher liege die Zukunft bei immer größeren Betrieben. "Trotzdem werden Nebenerwerbsbetriebe mit über 60% weiterhin den Großteil ausmachen", sagte er.
Zudem müssten sich die Landwirte auch auf den gesellschaftlichen Wandel beispielsweise bei Ernährungsgewohnheiten einstellen. Die Nachfrage nach Ersatzprodukten werde höher. „Die Rohstoffe für pflanzlichen Fleisch- und Milchersatz können von der heimischen Landwirtschaft produziert werden.“ Das könnte die Einbußen aus dem Minderverkauf von Milch und Fleisch kompensieren. „Wir werden immer mehr zu Umweltschützern“, fasste Mederle diesen gesellschaftlichen Umbruch zusammen. Gemeint war damit auch, dass der Verbraucher mehr regional und umweltbewusst einkaufen möchte. „Das funktioniert aber nur, wenn auch die Bereitschaft besteht, mehr für Lebensmittel auszugeben.“ Investitionen bräuchten Planungssicherheit, und die sei für Landwirte nur gegeben, wenn sichergestellt werde, dass neuartige Produkte auch eine entsprechende Zahl an Käufern findet.
Die Maschinenringe, so schloss der Vortragende, stünden beratend an der Seite der Landwirte und gemeinsam könnte dieser neuerliche Wandel bei der Landwirtschaft angegangen werden.




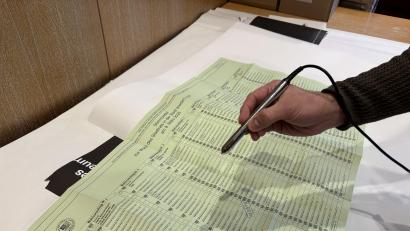












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.