Mit etwa 300 Teilnehmern - Angehörige der Häftlinge von damals, Vertreter der Zentralräte der Juden, der Sinti und Roma in Deutschland, aus Politik und Kultur - hatten die Veranstalter gerechnet, gekommen waren mehr als 500. Möglicherweise eine Folge der erzwungenen Pause; das „Wir haben euch vermisst“ des Gedenkstätten-Leiters Jörg Skriebeleit scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Möglicherweise die sichtbar zum Ausdruck gebrachte Verneigung vor einer vielfach ausgezeichneten Gedenkstättenarbeit, die auch an diesem Tag wieder mehrfach gelobt wird.
Während die Feier des 75. Jahrestages wegen der Pandemie gar nicht erst möglich war, schwebt über dem diesjährigen Gedenkakt unausgesprochen die Zeitenwende, die der Angriffskrieg in der Ukraine anzukündigen scheint. Offizielle Vertreter aus Russland und Weißrussland waren ausgeladen worden, für die ehemaligen Häftlinge beider Nationen wurden von seiten der Gedenkstätte aus Kränze in neutralen Farben niedergelegt. Einen Schritt, den Landtagsvizepräsident Karl Freller als Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten als notwendig unterstrich, alles andere „wäre eine Zumutung gewesen für die Vertreter aus der Ukraine“. Freller spricht von einer „Schizophrenie der Geschichte“. Holocaust-Überlebende müssten aus der Ukraine vor denjenigen fliehen, die sie einst befreit hatten, oder sie stürben unter deren Bombenhagel wie zuletzt der 96-jährige Borys Romantschenko in Charkiw.
Wichtige Bildungsarbeit
Prominente Redner des Gedenkaktes sind vor der Kranzniederlegung im „Tal des Todes“ Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) und der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU), beide seit vielen Jahren der Gedenkstätte in Flossenbürg eng verbunden.
Roth spricht von der schweren Erkenntnis aus den Gräueltaten der Nazi-Diktatur, „dass Mensch und Bestie nicht von einander zu trennen sind“. Die Bestie habe in den Konzentrationslagern nicht etwa menschliche Gestalt angenommen, die Bestie lauere im Menschen selbst, „sie lauert in uns“. Damals wie heute sei sie „eine menschliche Möglichkeit“. Nur diese Erkenntnis lasse die Warnung des italienischen Schriftstellers und Holocaust-Überlebenden Primo Levi begreifen: „Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen.“
Mit der Erinnerung der Überlebenden umzugehen, bedeute, verstehen zu wollen. An der Stelle kommen Roths Worten zufolge die Gedenkstätten ins Spiel mit ihrer Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Flossenbürg stehe dabei mit seinem Leiter Jörg Skriebeleit für eine Entwicklung, die immer neue Formen der Erinnerungsarbeit anbiete. Für Beckstein kommt dieser Arbeit, wie er sagt, vor allem vor dem Hintergrund der schwindenden Zahl von Zeitzeugen enorme Bedeutung zu. Er unterstütze aus dem Grund auch die Forderung, den Besuch in einer KZ-Gedenkstätte zu einem verpflichtenden Teil der Lehrpläne zu machen.
Kurzer Weg vom Hass zum Mord
Alle Redner warnen vor ernst zu nehmenden Entwicklungen, die Freiheit und Demokratie untergraben. Das Wissen um die eigene Vergangenheit sei für die Verteidigung der Demokratie unerlässlich, sagt Roth. Und die Gegner seien keine zu vernachlässigende Randgruppe, nicht in Deutschland, nicht andernorts in Europa. Freller spricht von dem bisweilen kurzen Weg vom Hass zum Mord. Dass auf Querdenker-Demonstrationen der Judenstern getragen werde, sei „an Anmaßung und Ignoranz nicht zu überbieten“, sei eine „Relativierung, wie es schlimmer nicht geht“.
Vor einer anderen Relativierung warnt Beckstein: Putin und dessen Krieg in der Ukraine dürften keinesfalls mit Hitler und Nazi-Deutschland verglichen werden.
Die Überlebenden unter den Teilnehmern
- Max Emanuel, Herzog in Bayern (geb. am 21.1.1937 in München)
- Erwin Farkas (geb. am 28.8.1929 in Ondód/Ungarn)
- Martin Hecht (geb. am 3.11.1931 in Ungarn)
- Josef Salomonovic (geb. am 1.7.1938 in Ostrava/Tschechien)
- Shelomo Selinger (geb. am 31.5.1928 in Jaworzno/Polen)
- Leon Weintraub (geb. am 1.1.1926 in Lodz/Polen)














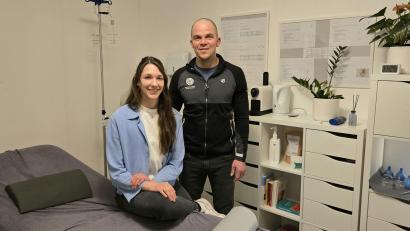






Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.