(ak) Die Kulturfreunde Kaibitz feierten am Samstagnachmittag mit Führungen und einem anschließenden Fest im Biergarten und Rittersaal ihr 15-jähriges Bestehen. Gleichzeitig wurde dazu die alte Kunstmühle 100 Jahre alt und vor 200 Jahren das Brauhaus in der Schlossschänke in Betrieb genommen. Ab 16 Uhr trafen sich die Mitglieder - aber zu wenige Gäste -, dieses Jubiläum zu feiern und sich über die historischen Anlagen und Gebäude sowie deren Verwendung von Fachleuten informieren zu lassen.
Der Vereinsvorsitzende Ely Eibisch begrüßte die Teilnehmer aus Bremen bis Starnberg und Bayreuth, besonders Kemnaths zweiten Bürgermeister Hermann Schraml. Eibisch: "Wir feiern heute unser Vereinsjubiläum mit zwei historischen Führungen zu den Themen 'Die Wege des Bieres und des Getreides'". Eibisch erinnerte an die erste Großveranstaltung "Strohhenge" 2004, als man das Steindenkmal "Stonehenge" in Originalgröße auf den Wiesen vor der Schlossschänke nachbaute. Eine von Florian Trassl zusammengestellte Bilderausstellung mit digitalen Aufnahmen von Max Popp durch das 15-jährige Vereinsgeschehen ergänzte die Jubiläumsveranstaltung eindrucksvoll. Müllermeisterin Petra Schuster aus Eisersdorf übernahm die Führung durch die vor 100 Jahren errichtete Kunstmühle, die von Mitglied Roland Ehler entrümpelt und wieder begehbar gemacht wurde.
Schale und Schrot Futter
Im Erdgeschoss der Kunstmühle erläuterte die Müllerin, dass das Getreide zunächst gereinigt, grob gebrochen, geschrotet und dann zu den Mahlgängen mit dem Becherelevator in das oberste Stockwerk transportiert wurde. "Zuerst gab es eine Mühle mit natürlichen Mühlsteinen, dann machten die künstlichen Mahlwalzenstühle und modernere Siebverfahren eine Kunstmühle mit höherwertigen Mahlprodukten daraus", erklärte sie. Rund 13 bis 15 Mal wurde das Rohprodukt Getreide gequetscht, gemahlen und gesiebt. Das Mehl kam zum Bäcker, die Schale und Schrot als Futter in den Viehstall.
Im ersten Obergeschoss bestaunten die Teilnehmer die alten Antriebswellen und Riemen der Transmission samt den Holzsilos. Schuster erläuterte, dass früher das Mehl zu einer Sorte gemischt wurde. Heute wird das Mehl in verschiedenen Sorten wie Typ 405 bis 550 gesiebt, wobei letzteres qualitativ hochwertiger ist. Die für die Führung und Transport des Getreides verwendeten Holzrohre wurden aus Hygienegründen später durch Metallrohre ersetzt. "Oftmals waren Brände in Mühlen häufig; dies geschah durch Lagerschäden stehengebliebene Riemenscheiben, die durch die sich durch Reibung des Antriebsriemens entzündeten", berichtete Schuster. Mit unterschiedlichen Scheibendurchmessern wurde die notwendige Maschinengeschwindigkeit in den Ebenen geregelt.
Im zweiten Obergeschoss zeigte die Müllermeisterin die Wirkungsweise des Plansichters, der mit 24 Siebebenen das Getreide in feines Mehl, Dunst, Grieß bis zum groben Schrot trennt und mit sechs Sieben das Mehl siebt. Das Grobe wird immer wieder in den Walzenstühlen zerkleinert und das erneut gewonnene Mehl abgesiebt. Die Besucher nahmen mit, dass der Ablauf in einer modernen Mühle der gleiche wie früher ist, jedoch heute mit mehr Hygiene und rationeller Technik gearbeitet wird. Die Meisterkurse für Müller sind auf vier Jahre ausgebucht. Fühl- und Sichtproben der Mühlenprodukte rundeten die wissenswerte Führung der Müllermeisterin ab.
Im Rittersaal der Schlossschänke berichtete Eibisch nach dem Gang durch das Gebäude, dass dieses im Jahr 1818 als Betriebsgebäude der neuen Brauerei errichtet wurde. Der holzbefeuerte Sudkessel und -pfanne stand bis 1982 im heutigen Saal der Gaststätte. Die Schlossschänke bewirtet ab diesem Zeitpunkt in seiner jetzigen Form und jetzigem Umfang seine Gäste.
Pinkeln verboten
Die angehende Braumeisterin Franziska Scharf aus Oberbibrach erläuterte den Weg des Mahlgetreides und des Bieres durch das Gebäude. "Das Bayerische Reinheitsgebot war das erste deutsche Verbraucherschutzgesetz", berichtete sie. Die erste schriftliche Erwähnung zur Herstellung des Bieres stammt aus dem Jahr 2800 vor Christus in Keilschrift aus Mesopotamien. Erst 1551 wurde die Hefe zu den Inhaltsstoffen Wasser, Hopfen und Malz hinzugefügt. Zunächst wird Gerste zur Enzymbildung vermälzt. Nach dem Einweichen und Ankeimen lagert es im Dachboden und wird danach auf der Darre getrocknet. Nach dem Schroten wurden das Malz und der Hopfen dem Wasser zugegeben und in der Maisch- und Würzepfanne erhitzt.
"Brauereien standen früher immer vor der Stadtgrenze, um sauberes Wasser zum Brauen zu haben. Pinkeln am Bachoberlauf war verboten", erklärte sie scherzhaft. Nach dem eintägigen Abkühlen im Kühlschiff fließt die Würze für rund eine Woche in den Gärbottich. Anschließend wird das Jungbier in großen Fässern im mit Teicheis gekühlten Keller gelagert. Das letzte Bier der Sorte Märzen schloss im März die Brausaison in der kühlen Jahreszeit ab. Die zweitwichtigste Berufsgruppe beim Brauen war der Böttcher, der die Fässer herstellte.
Die Teilnehmer konnten anschließend in einem Fragebogen zum Thema Bierbrauen ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Ein Rundgang durch die Schlossschänke rundete die Führung ab. Das Besichtigungsprogramm ergänzte die geschützte alte Eiche an der Marienkapelle der Familie Eibisch ab. Sie hat einen Durchmesser von 2,10 Metern und ist in der Gegend einzigartig. Dort stand ein Mittelalterzelt, in der die Urkunde aus 1936 ausgestellt wurde.
Von 19 bis 21 Uhr unterhielt das Trio "KEMs" in der Schlossschänke, wo die Gäste kulinarisch vom Team der Schlossschänke um Wirtin Martina Eibisch bestens versorgt wurden. Der Kulturverein sorgte zudem für eine Kinderbelustigung, zu der auch ein Luftgewehrschießen im Schießstand des Schützenvereins und eine Hüpfburg gehörten.













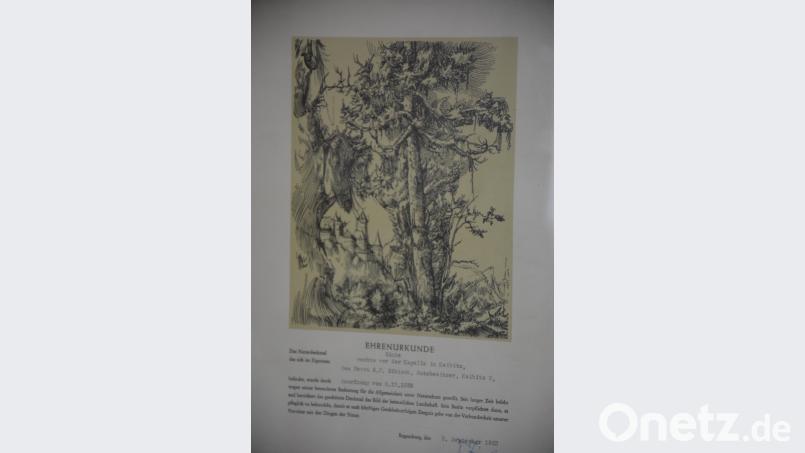




















Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.