Neben der Tarifpolitik und der Arbeit in den Betrieben sehen es die Gewerkschaften als ihre Aufgabe an, sich mit der Geschichte zu befassen und Lehren daraus zu ziehen. Das tat der Verdi-Ortsverein auf einer Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Der Vorsitzende des Gedenkstätten-Fördervereins, Dekan Karlhermann Schötz, führte durch das Gelände.
Rund 100 000 Häftlinge, fast ausschließlich Männer, waren zwischen 1938 und 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt. Insgesamt kamen mindestens 30 000 Menschen ums Leben. Sie wurden ermordet, verhungerten oder starben an den Folgen der Zwangsarbeit. Während sie zunächst die Granitvorkommen in Flossenbürg ausbeuteten, mussten sie ab 1943 für die Firma Messerschmitt Flugzeugteile montieren.
Aber nicht nur in Flossenbürg selbst waren die KZ-Häftlinge den Schikanen der SS-Schergen ausgesetzt, sondern auch in vielen anderen Orten. Ein System von rund 80 Außenlagern reichte über Bayern bis nach Böhmen und Sachsen, um manchen Firmen billige Arbeitskräfte zu liefern. Oft werde in der Öffentlichkeit gesagt, Flossenbürg sei ja kein Vernichtungslager wie Auschwitz gewesen. "Tatsächlich fand in Flossenbürg Vernichtung durch Arbeit statt", schilderte Dekan Schötz.
Eine Dauerausstellung zeigt am Beispiel von Einzelschicksalen auf, wie das unmenschliche System funktionierte. Um die Macht über die Zigtausende an Häftlingen zu sichern, ging die SS nicht nur mit äußerster Brutalität vor, sondern nutzte auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppe aus. So setzte sie in Flossenbürg Straftäter als sogenannte "Kapos" ein. Um sich bei der SS beliebt zu machen, schikanierten sie Menschen, die aus politischen oder rassistischen Gründen inhaftiert waren.
Vergessen und Verdrängen der Geschichte seien lange Zeit nicht zufällig vonstatten gegangen, sondern von mancher politischen und gesellschaftlichen Seite beabsichtigt gewesen. "Dem Vergessen muss Aufklärung, nicht mit erhobenen Zeigefinger, entgegen gesetzt werden", betonte Dekan Karlhermann Schötz.







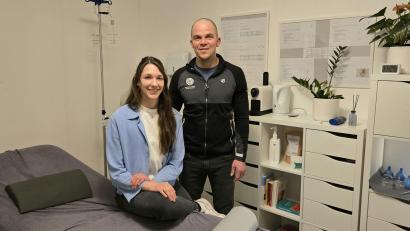






Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.