Vor allem dann, wenn gesellschaftliches Leben durch Krisen und Katastrophen ins Wanken gerät, verbreiten sich Verschwörungsfantasien und antisemitische Ressentiments. Markus Weiß, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, referierte als Gast der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft im Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg über dieses Thema.
"Eine kleine, verschworene und geheime Gruppe will aus niederen Beweggründen eine Institution, ein Land oder die ganze Welt kontrollieren oder zerstören" - allein an dieser Definition könne man erkennen, dass Verschwörungsdenken stark mit "gefühlten Wahrheiten" zu tun habe und wenig mit Fakten, so der Referent.
"Nichts ist wie es scheint"
Den meisten Verschwörungsmythen sei gemeinsam, dass deren Anhänger davon ausgingen, dass "nichts ist wie es scheint". Es müsse eine agierende Gruppe geben, die für eine Krise verantwortlich sei, denn es gäbe ja "keine Zufälle", und gerade große Ereignisse hätten große Ursachen - eben die Machenschaften der Verschwörer.
Die eigene "Theorie" führe dann zu Schwarz-Weiß-Denken und Feindbildkonstruktionen. Man gehöre dann exklusiv zu den Guten, die "es" verstanden hätten und fühle sich dann moralisch überlegen. Im Extremfall resultiere aus diesem Denken aber Gewalt. Je drastischer der Gegner gezeichnet werde, umso mehr erschienen Widerstand und Gewalt legitim.
Schockiert bis amüsiert
Markus Weiß veranschaulichte seine Ausführungen mit Beispielen, zum Beispiel die gesäten Zweifel an Lady Dianas Unfalltod oder Aussagen über die Coronapandemie. Die Zuhörer waren schockiert bis amüsiert, als der Referent Beispiele aus einer Oberpfälzer Telegram-Gruppe zeigte, die auf alle möglichen Verschwörungserzählungen aufspringt.
Juden würden dabei oft als das "Urböse" hingestellt. Seit der Coronapandemie käme der Antisemitismus wieder verstärkt zum Vorschein. "Die Juden" als klassisches Feindbild würden auch hierfür verantwortlich gemacht.
Gezielt Emotionen hoch kochen
Woran erkennt man Verschwörungsdenken im Sprachgebrauch und in Schriften? Weiß stellte fest, dass sich wieder mehr Menschen trauten, zu sagen, dass "die Juden daran schuld" seien. Viel häufiger aber sei Antisemitismus an chiffrierten Ausdrücken wie "die Rothschilds", "die Globalisten" oder "die Bilderberger" zu erkennen.
Der Referent, der am Fachgebiet für Allgemeine Linguistik der TU in Berlin arbeitet, nannte bei Verschwörungstheoretikern häufig verwendete Ausdrücke. Sogenanntes Entlarvungsvokabular - "anscheinend", "mutmaßlich", "angeblich" - solle Zweifel säen, etwa an der Existenz des Coronavirus. Das Handeln der vermeintlichen Verschwörer werde mit Wörtern wie "inszenieren", "irreführen" oder "unter dem Deckmantel" beschrieben. Ihre Widersacher hingegen "decken auf", "entlarven" oder "demaskieren". Statt den FFP2-Mundschutz als solchen zu benennen, werde versucht, mit manipulativer Sprache wie "Maulkorb" oder "Sklavenmaske" die Emotionen hoch zu kochen und den Diskurs zu vergiften.

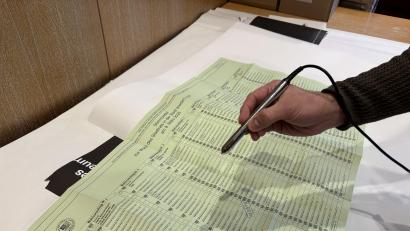












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.