Das Publikum war ungewöhnlich: Vor Auszubildenden der Firma Kassecker in Waldsassen schloss die Referentin ihre Erläuterungen: „Nein, ich bin nicht behindert: Ich werde von etlichen Umständen behindert – manchmal auch von Menschen.“ Dieses Fazit zog Doris Scharnagl-Lindinger, die seit fast 20 Jahren einen Rollstuhl braucht. Wo sie Chancen und Grenzen für mehr Inklusion auf Marktplätzen, bei Gebäuden und Wohnungen, in Freizeit und Gesellschaft sieht, trug sie anschaulich vor. Als Behindertenbeauftragte ist sie auf Gemeinde- und Landkreisebene tätig.
Ihren Erfahrungsbericht begann sie laut Mitteilung des Netzwerks Inklusion mit der Schilderung ihrer familiären Situation, ihren Erfolgen im Schießsport im Kader der Nationalmannschaft, als Paralympics-Teilnehmerin und Pistolentrainerin sowie Freizeitbeschäftigungen wie Reiten oder Tennis. Schwerpunkte ergaben sich dann aus ihrer Arbeit als Behindertenbeauftragte, als Leiterin einer Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreies Wohnen und Bauen“ und als ehrenamtliche Wohnberaterin.
Bezug zur Arbeit
Dabei verwies sie auch auf bürokratische oder politische Barrieren bei ihren Bemühungen, Barrieren für Menschen mit Behinderung zu beseitigen. Überraschend für die angehenden Bauleute sei gewesen, wie nahe ihre Arbeit manchmal den Bedürfnissen der Rollstuhlfahrerin kommt: Wie ist das mit Steigungs- und Gefällewinkel beispielsweise bei Bürgersteigen oder Eingängen? Ab wann provoziert die Querneigung ein Kippen des Rollstuhls? Müssen Zwischenpodeste sein? Welche Rolle spielt das Material? An solchen Beispielen werde deutlich, wie froh Personen mit Kinderwägen, Rollatoren, Krücken oder mit Gehbehinderung über Barrierefreiheit auf Marktplätzen oder in Bahnhöfen sind.
Christina Ponader, die Leiterin des Netzwerks Inklusion, sieht laut der Mitteilung in dem Modellprojekt bei der Firma Kassecker eine gute Möglichkeit, gesellschaftspolitische Themen jungen Leute nahezubringen. Sie selber hatte im Campus der Firma bereits ihre Projekte vorgestellt. „Das Thema Inklusion hat viele Facetten, sie brauchen alle eine noch stärkere Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Entscheidern: so etwa für technische Hilfsmittel, für verständliche Sprache, für vorurteilsfreies Denken, für mehr Teilhabemöglichkeiten“, wird sie zitiert.
Aufsuchende politische Bildung
Friedrich Wölfl, der sich im Rahmen des Netzwerks Inklusion in der „Demokratie-Werkstatt für alle“ engagiert, hob die Aufgeschlossenheit der Firma Kassecker hervor: „Sie bietet mit ihrem Campus den jungen Leuten hervorragende Chancen, ihre Persönlichkeit, ihr Allgemeinwissen und ihre Urteilskompetenz zu fördern.“ Er hoffe, dass andere Firmen ihren Auszubildenden ähnliche Möglichkeiten bieten. Dieses Modell einer „aufsuchenden politischen Bildung“ erlaube es, jungen Leuten neben ihrer beruflichen Ausbildung Themen nahezubringen, die für das Zusammenleben – nicht nur in der Arbeitswelt – immer wichtiger würden. Ziel sei, Verständnis für demokratisches Zusammenleben zu fördern.
Der Leiter des Firmen-Campus, Andreas Malzer, freut sich, die „Demokratie-Werkstatt“ als Partner gewonnen zu haben. „Neben der berufsfachlichen Ausbildung eröffnen wir unseren Auszubildenden weitere Formate zur Horizonterweiterung. Dazu gehören Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Erwünschter Nebeneffekt: Das sind alles auch Themen bei den Prüfungen der Industrie- und Handelskammer.“
„Nein, ich bin nicht behindert: Ich werde von etlichen Umständen behindert – manchmal auch von Menschen.“




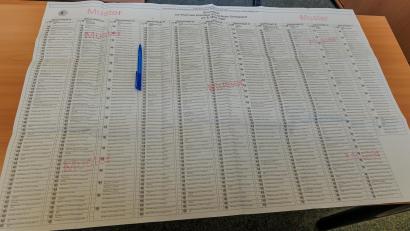












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.