„Warum musste Jesus am Kreuze sterben?“, lautete die Ausgangsfrage des religionswissenschaftlichen Vortrags von Professor Notger Slenczka aus Berlin. Der Religionswissenschaftler und Lehrstuhlinhaber der Berliner Humbold-Universität sprach zum Auftakt der Herbst-/Winter-Vortragsreihe des Freundeskreises Weiden der Evangelischen Akademie Tutzing.
Überschrieben war der Vortrag mit dem Titel „Sühne und Selbsterkenntnis“. Der erste Teil bewegte sich fast ausschließlich im theologischen Theoriebereich. Bibel und Religionswissenschaft hätten auf die Frage nach der Begründung des Kreuzestods Jesu mehrere Antworten entwickelt. Man könne sich für die eine oder andere entscheiden, stellte der Professor fest. Eine Antwort könne lauten: „Gott ruft nach einem Opfer und Jesus trägt, was die Sünder tragen müssten.“ Für viele Theologen sei dies nur schwer zu verstehen, denn sie können sich mit der Rolle von Jesus als Sühneopfer schwer abfinden. Unter Bezug auf den mittelalterlichen Theologen Anselm von Canterbury vertiefte Slenczka diese Deutung des Opfertods Jesus dann. Anselm sagt: „Nur wenn man versteht was Sünde ist, versteht man auch, dass der Tod notwendig ist." Und: „Gott wird Mensch und erbringt als Mensch die Leistung, die Gott versöhnt.“ Vergebung werde dabei an Sühne geknüpft.
Für eine etwas andere Sinndeutung des Todes Jesu griff Slenczka dann auf Shakespeare und sein Drama Macbeth zurück. Obwohl Gott in diesem Drama nicht vorkommt, lernt der Zuschauer laut Slenczka vor allem aus der Rolle der Lady Macbeth: „Untat und Sünde ist ein Problem der Sünder.“ Schuld sei unerträglich, sie kehre immer wieder zurück. Vergessen sei keine Lösung. Genau an dieser Stelle setze die andere Interpretation des Todes Jesu an. Dazu zitierte Slenczka Martin Luther. Gottvater habe zu Jesus gesagt: „Sei aller Menschen Person, der du aller Menschen Sünden trägst.“ Es gehe bei dieser Interpretation also nicht um die Wiederherstellung der Ehre Gottes, sondern um die Erlösung des Menschen, der mit seiner Schuld und Sünde nicht fertig wird. Dass dies so ist, wurde im Vortrag verallgemeinert und mit Beispielen aus dem alltäglichen Leben belegt.
Es gehöre zu den menschlichen Eigenschaften, immer wieder Umstände zu suchen, die einen Fehler entschuldigen. Slenczka sprach von einem „riesigen Schuldverschiebebahnhof“. Beispiel: In Berlin passiert ein Unfall mit einem SUV, sofort werden die SUVs verteufelt und sind schuld am Klimawandel. Schuld werde ständig herumgereicht. Der Mensch schaffe es nicht, eigene Schuld selbst zu akzeptieren. Hier nahm Slenczka wieder auf den Tod Jesu Bezug, denn dieser befreie den Menschen von seiner Schuld. Slencka räumte in der Diskussion aber ein: „Alles ist keine endgültige Antwort, das ist das Spannende an der Theologie.“ „Gilt diese Interpretation auch für den Holocaust?“ wollte ein Zuhörer wissen und hörte, dass der Referent vor der Antwort etwas zögerte, aber meinte: „Ob der Teufel am Ende erlöst wird, wird immer wieder diskutiert.“
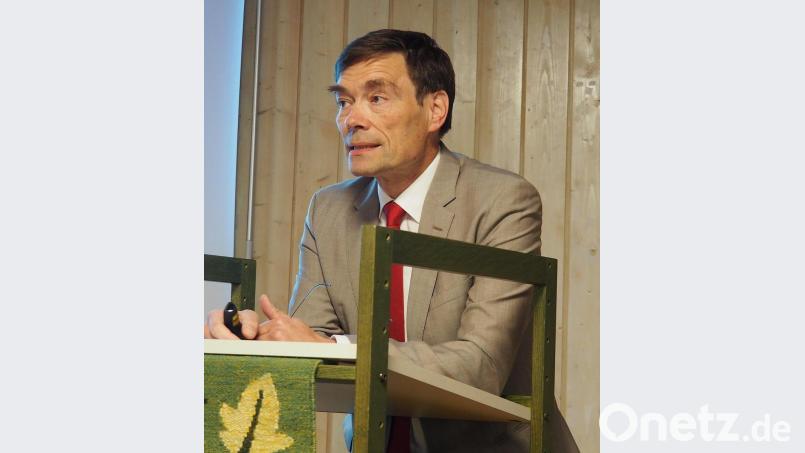













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.