Der Themenbereich Bildende Kunst gehört eher selten zum Veranstaltungsprogramm des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing. Und dass sogar ein Künstler persönlich einen Vortrag hält, ist die absolute Ausnahme. Doch anlässlich des „Bauhaus-Jubiläumsjahrs“ schien den Veranstaltern dies gut passend.
„100 Jahre Bauhaus, technisch-wissenschaftliche und soziale Aspekte der Gestaltung“ war der Vortrag des Pädagogen und freischaffenden Künstlers Axel Thomas Schmidt überschrieben. Es war die Abschlussveranstaltung der diesjährigen Vortragsreihe. Im ersten Teil seines Vortrags beschäftigte sich Schmidt eingehend mit der Vorgeschichte der Gründung des Bauhauses in der Zeit des 19. Jahrhunderts. Dabei ging es unter anderem um die Weltausstellung im Jahre 1851 in London und um die „Arts and Kraft-Bewegung“.
Minutiös genau recherchierte der Referent die Ereignisse und Namen dieser Zeit. Er sprach über John Ruskin, Gottfried Semper, William Morris und Hermann Mutesius und viele andere. Die meisten von ihnen waren Architekten. Schon damals ist es um das Beziehungsgeflecht zwischen Kunst, Handwerk und Maschine gegangen, stellte Schmidt fest. „Soll man die Einschränkung der künstlerischen Freiheit durch die Industrie akzeptieren?“ sei eine zentrale Frage gewesen. Schmidt zeigte auch Bilder vom „Thebes Hocker“ dessen Exemplare bis heute noch hohe Preise erzielen. Erwähnt wurde auch Adolf Loos, der als einer der Vorläufer moderner Architektur gilt. Laut Schmidt hatte dies alles „in einer von Männern gelenkten Welt“ stattgefunden.
Nur wenige kunstnahe Einrichtungen hätten zur Jahrhundertwende Frauen aufgenommen und Frauen hätten keinen Zugang zur Aktmalerei gehabt. In Kunstgewerbeschulen hätte es eher noch Ausbildungsplätze für Mädchen gegeben. Damit leitete der Referent allmählich zur Thematik Bauhausgründung durch Walter Gropius im Jahre 1919 über. Dort gab es sowohl männliche als auch weibliche Lehrlinge. Ungewöhnliche Lehrmethoden und alternative Formen des Zusammenlebens hätte es dort gegeben. Es sei ein multikulturelles und von gesellschaftlichen Zwängen befreites Leben gewesen. „Verschmelzung von Kunst und Industrie ist die DNA des Bauhauses“, stellte Schmidt fest. Über Walter Gropius und sagte er: „Gropius bejahte die industrielle Produktion und wollte sie unter das Primat der Kunst stellen.“ Transparente flache Gebäude und einfache Formen standen im Vordergrund. Damit wurde auch eine Antwort auf die vor der Gründung des Bauhauses vielfach gestellte Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst, Handwerk und industrieller Produktion gegeben.
Der Referent schilderte dann die gesamte Geschichte des Bauhauses, seine Umzüge nach Dessau und Berlin bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933. Und er zeigte das gesamte Spektrum des dortigen künstlerischen Schaffens von der Architektur bis zur Fotografie auf. Kritik übte Schmidt an den kürzlich in einem Fernsehbericht über Gropius erweckten Eindrücken in Bezug auf sein Verhältnis zu Frauen. „Ich kann mich dem Film nicht ganz anschließen.“ Schließlich sei Gropius Zeit seines Lebens mit seiner Frau Ise verheiratet gewesen, meinte Schmidt.
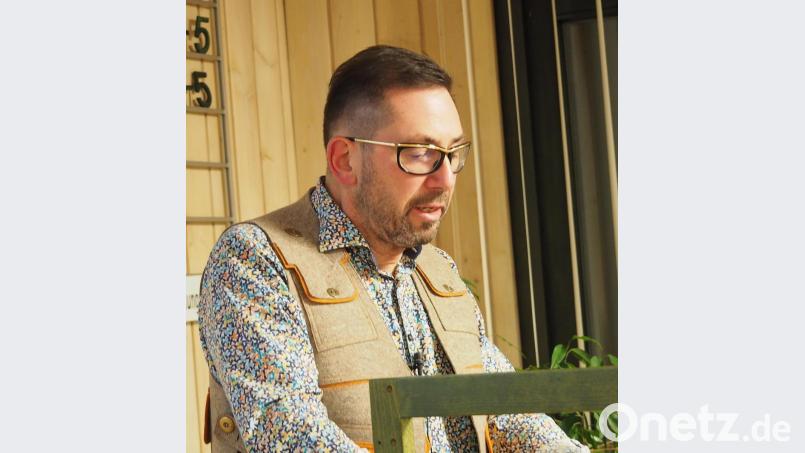













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.