Der bayerische Philologenverband (bpv) warnt vor einer umfassenden Digitalisierung an Bayerns Schulen. In einer aktuellen Umfrage des Lehrerverbandes an Gymnasien sowie Berufs- und Fachoberschulen sprachen sich 89 Prozent der Lehrkräfte für ein verstärktes analoges Lernen aus. Nur elf Prozent votierten für eine weitere Digitalisierung des Unterrichts. "Die Antwort lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig", kommentierte der bpv-Vorsitzende Michael Schwägerl das Ergebnis. Das Unbehagen unter Lehrkräften jeden Alters sei angesichts einer "überbordenden Digitalisierung" groß.
Als Konsequenz forderte Schwägerl von der Staatsregierung, ihre Digitalisierungspläne für die Schulen zu überdenken. "Wir sollten aus den Fehlern anderer lernen", sagte Schwägerl mit Blick auf skandinavische Länder. Diese galten lange als Vorreiter der Digitalisierung an den Schulen, drehen das Rad nun aber wieder massiv zurück. Als Gründe nannte Schwägerl das hohe Ablenkpotenzial bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht, Defizite bei der Vermittlung von Grundkompetenzen und eine insgesamt viel zu hohe tägliche Bildschirmzeit bei Kindern und Jugendlichen. "Da will ich Bayern nicht als Spitzenreiter sehen", sagte Schwägerl.
"Menschliche Komponente" im Fokus
"Der Weg zu einer allumfassenden Digitalisierung schon in der Grundschule kommt für uns nicht in Frage", schloss er daraus. Unter den Lehrkräften gebe es den weit verbreiteten Wunsch nach mehr analogem Lernen, um wieder die "menschliche Komponente" im Unterricht zu betonen. Gerade zur Vermittlung grundlegender Kompetenzen brauche es Bücher, Hefte und Stifte. "Wir müssen wieder mehr schreiben statt tippen und wischen", sagte Schwägerl. Schule sei "kein Digitallabor". Es dürfe in Bayern nicht so weit kommen wie in Dänemark, wo der Bildungsminister sich kürzlich bei den Jugendlichen dafür entschuldigt habe, sie zu "Versuchskaninchen in einem digitalen Experiment" gemacht zu haben.
Der Einsatz digitaler Medien sollte nur dann erfolgen, wenn dies pädagogisch sinnvoll sei, erklärte Schwägerl. Bisherige Erfahrungen in den Tablet-Klassen hätten gezeigt, dass eine regelmäßige Verwendung von Handys oder Tablets im Unterricht erst in der Oberstufe mehr Vor- als Nachteile bringe. In der Mittelstufe sei der Einsatz nur in eingeschränktem Umfang und mit klaren Regeln zu befürworten. Schwägerl sprach sich deshalb gegen die Pläne der Staatsregierung aus, bis 2028 alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen mit digitalen Endgeräten auszustatten. Dies sollte erst in der Mittelstufe ab der 8. Klasse angestrebt werden. Damit ließen sich für Staat und Eltern auch unnötig hohe Kosten vermeiden.
Handy-Nutzung verbieten?
Eine Mehrheit der Gymnasiallehrkräfte hat sich in der Umfrage zudem dafür ausgesprochen, die Regeln für die Handy-Nutzung an Schulen zu verschärfen. Derzeit legen die Schulen weitgehend eigenständig fest, wann und wie die Schülerinnen und Schüler ihre Smartphones auf dem Schulgelände nutzen dürfen. 24 Prozent der Befragten plädierten für eine Verschärfung der schuleigenen Regeln, 28 Prozent forderten eine bayernweit einheitliche Beschränkung. Schwägerl folgerte aus dem Ergebnis, dass es an den Schulen offenbar den verbreiteten Wunsch gebe, bei den bestehenden Regelungen zur Handy-Nutzung nachzujustieren.
Klare Regeln verlangt der bpv außerdem bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) an den Schulen. Hier müsse der Freistaat datenschutzkonforme und rechtssichere Tools in der "BayernCloud Schule" zur Verfügung stellen. Zudem wünschen sich die Lehrkräfte Hilfen beim Erkennen von KI-generierten Referaten oder Texten ihrer Schüler. Besonders relevant sei dies vor allem bei der Abschlussarbeit im W-Seminar der Oberstufe. Hier werde es immer schwerer, zwischen der eigenen Leistung der Schüler und KI-gefertigten Textpassagen zu unterscheiden, hieß es.










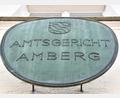



Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.