Der Artikel erschien im Weidener Lokalteil. Es war ein Gerichtsbericht, ergänzt mit einer Reihe von interessanten Informationen zu dem Angeklagten, die die Autorin am Rande der Verhandlung recherchiert hatte. Der 35-jährige Zahnarzt stand wegen des Vorwurfs des Titelmissbrauchs vor dem Kadi. Der Mann trägt den tschechischen Grad eines Doktors der Medizin (MUDr.) und hätte sich nicht "Dr." nennen dürfen.
Als langjähriger Abonnent könne er "diese Art von Journalismus nur zutiefst ablehnen", schreibt der Leser, der eine Zahnarztpraxis im Landkreis Amberg-Sulzbach betreibt. Deshalb, so betont er, sei der 35-Jährige für ihn auch kein Konkurrent. Die Redaktion habe es geschafft, aus dem Tatbestand des "bewusst falschen Führens eines Doktortitels durch den tschechischen Kollegen eine Art redaktionellen Werbeartikel für seine Praxis zu machen", kritisiert der Mediziner. Er stört sich an dem "Hochglanzfoto" des 35-Jährigen mit Piratentuch. Er findet die Anmerkung überflüssig, dass es dessen Spezialität sei, Patienten die Furcht vor dem Zahnarzt zu nehmen. Und auch die Besonderheit, dass in der Praxis des Tschechen mitunter Heavy Metal laufe, habe "rein gar nichts mit dem Sachverhalt zu tun, es ist einfach Schleichwerbung".
Ich gebe dem Leser in einem Recht: Über die Relevanz dieser Punkte für den Sachverhalt lässt sich diskutieren. Um Schleichwerbung handelt es sich aber definitiv nicht, da muss ich dann doch widersprechen. Dazu taugen die Hinweise auf das Piratenkopftuch, auf Heavy-Metal-Klänge in der Praxis und auf Anti-Angst-Behandlung wirklich nicht. Sie verdeutlichen lediglich, dass der 35-Jährige nicht der Typ von Zahnarzt ist, wie man ihn normalerweise kennt. Im Zusammenhang mit der Gerichtsberichterstattung waren diese Infos also durchaus von Bedeutung, um für den Leser das Bild von dem doch etwas ungewöhnlichen Angeklagten abzurunden. Außerdem standen in dem Artikel ja auch die kritischen Anmerkungen des Richters zu dem tschechischen Zahnarzt.
Leser misstraut uns
Der Doktor mit Praxis im Raum Amberg-Sulzbach wirft am Ende eine Reihe von Fragen auf: Werde dem 35-Jährigen die Geldauflage von 2000 Euro jetzt mit einem großen Werbeartikel in der Zeitung vergolten? Wie viel hätte ihn eine halbseitige Annonce in der Zeitung gekostet? Oder habe er schon Werbung geordert, eventuell in einer unserer Zeitungsbeilagen. Bekomme er "vielleicht deswegen noch einen für ihn positiven Artikel über ein eigentlich strafbares Verhalten ,geschenkt'"?
Ich kann an dieser Stelle gleich beruhigen: Derartige Gedanken, wohl der großen Verärgerung über den Artikel entsprungen, entbehren jeder Grundlage. Bei uns wird weder etwas vergolten noch bekommt der Betroffene etwas geschenkt noch haben wir mit ihm einen Werbevertrag. Bei uns kann sich keiner eine positive Berichterstattung erkaufen.
Natürlich sind Medien auf Einnahmen aus Werbung angewiesen, ich betone: aus Werbung. Doch dürfen sie "redaktionellen Inhalt und die Werbung nicht vermischen", wie auch die Juristen der "Initiative Tageszeitung" (ITZ) unterstreichen. In Deutschland gelte ein striktes Gebot der Trennung von redaktionellem Teil und Werbung. Das sei in den Landespressegesetzen festgeschrieben.
In der Praxis freilich müssten sich immer wieder die Gerichte mit der Grenzziehung befassen. Denn so einfach sei diese nicht, gehöre es doch zum Informationsauftrag der Medien, über Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen zu berichten: "Es ist kaum möglich, über die Signierstunde eines berühmten Autors in der Buchhandlung zu berichten, ohne den Anlass, die Präsentation eines neuen Romans zu erwähnen. Wenn das Autohaus dem Wohlfahrtsverband ein abgelegtes Dienstfahrzeug schenkt, kann der Lokalredakteur an diesem Thema kaum vorbei und dabei schlecht die Marke des Fahrzeugs und den Namen des Autohauses verschweigen. Und auch die Übergabe der großzügigen Computerspende an eine örtliche Schule ist ein Thema für die Lokalzeitung, die dabei das großzügige Wirtschaftsunternehmen nicht unerwähnt lassen kann. Der Journalist schreibt es mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen in der Zeitung, weil er seiner Chronistenpflicht genügen muss."
Nur Sachinformation
Hat solche Berichterstattung den Nebeneffekt, sich vorteilhaft auf die Geschäfte des Unternehmens auszuwirken, so sei das grundsätzlich "kein Problem und keinesfalls als Schleichwerbung zu bezeichnen", sagen die ITZ-Juristen. Wichtig ist in ihren Augen nur, "dass die Sachinformation im Vordergrund steht und nicht mit übermäßig lobenden Aussagen über das Unternehmen, seine Leistungen und Produkten vermischt ist". Ein Bericht sei nur dann unzulässig, wenn er ein Produkt so umfangreich erwähnt, das dies nicht mehr als sachliche Information zu verstehen ist. Oder auch, wenn die Lokalzeitung ein örtliches Geschäft über den grünen Klee lobe und von einem tollen Warenangebot und hervorragender Beratung schwärme.
Pressekodex, Richtlinie 7.2 (Schleichwerbung)
„Redaktionelle Veröffentlichungen, die auf Unternehmen, ihre Erzeugnisse, Leistungen oder Veranstaltungen hinweisen, dürfen nicht die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten. Eine Überschreitung liegt insbesondere nahe, wenn die Veröffentlichung über ein begründetes öffentliches Interesse oder das Informationsinteresse der Leser hinausgeht oder von dritter Seite bezahlt bzw. durch geldwerte Vorteile belohnt wird.“
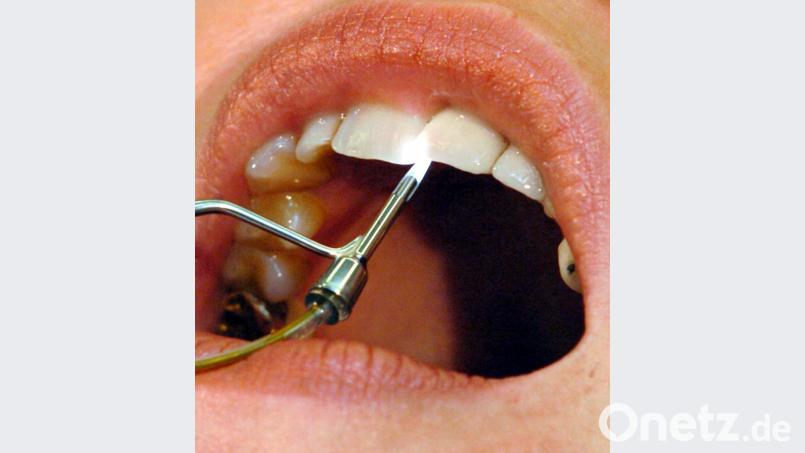















Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.