Mit seiner 43. Publikation erleichtert der Heimatverein Eschenbach in der Vorweihnachtszeit die Suche nach einem Geschenk für den Gabentisch. Das 113-seitige Werk beleuchtet in elf Beiträgen eine beachtliche Vielfalt von Themen, die Freunden historischer Forschungsergebnisse viel Lesevergnügen bereiten.
Erstmals gesellt sich Mathias Helzel zu den regelmäßigen Autoren und überrascht die Betrachter mit der Rekonstruktion historischer Gebäude. Dazu hatte er aus dem Archiv des Heimatvereins alte Aufnahmen Eschenbacher Gebäude, Pläne und Informationen zum Urkataster erhalten. Mit Hilfe dieses Grundwissens hat er in einem aufwändigen Verfahren eindrucksvolle Rekonstruktionen geschaffen, die den Betrachter in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen. Karlheinz Keck sieht in der Arbeit Helzels ein interessantes Experiment, damit man eine Vorstellung des alten Stadtbildes bekommt, „auch wenn vieles natürlich Spekulation bleiben muss“.
Helzel widmet sich beispielsweise dem ehemaligen Oberen Tor an der Engstelle beim ehemaligen Vermessungsamt in Eschenbach. Es stammte aus dem Jahr 1536 und wurde im März 1864 als „baufällig und reparaturbedürftig“ beschrieben. Für einen Abbruch im Oktober 1866 hatte sich der Bezirksamtmann eingesetzt, der täglich die drangvolle Enge beim Durchfahren des Tores mitbekam. Für die Rekonstruktion des stattlichen Ratshausturms diente ihm der Merianstich von Eschenbach aus dem Jahr 1644. Zu einer Montage an die Ostseite des Rathauses räumte er ein: „Ob der Rathausturm unterhalb oder oberhalb des Rathauses stand, ist ungeklärt. Nur archäologische Untersuchungen könnten hier neue Erkenntnisse bringen.“
Mit vielen baugeschichtlichen Informationen begleitet Bernd Thurn die Arbeit Helzels, geht auf die Baufälligkeit des Pflegschlosses (heute Landratsamt) und dessen Reparatur mit Umbau ein. Das Vorstellungsvermögen des Betrachters ist beim Ensemble Burggut, Benefiziatenhaus (abgebrochen 1900) und Kirche (noch ohne Anbau) ebenso gefordert wie beim Blick auf das Untere Stadttor mit zweigeschossigem Aufbau und Brücke über den Weidelbach. Einen Eindruck von der Größe der 1608 fertiggestellten Friedhofskirche, deren Demolation im Geiste der Aufklärung 1812 von der königlichen Regierung angeordnet wurde, vermittelt auch deren Rekonstruktion. Erhalten blieb nur der Chor. Beim Blick über die Stadtmauer hinaus widmet sich Helzel mit seinen Rekonstruktionen auch der Wallfahrtskirche auf dem Barbaraberg, dem „Schlössl“ von Haselhof, der Burg „Neuhaus“ bei Zettlitz, dem Schloss Metzenhof und dem Schloss Tagmanns.
Hans Ott liefert sieben Beiträge
Mit sieben Beiträgen bleibt Hans Ott Rekordlieferant. In seinem Artikel „Der Pfarrhof in Eschenbach und seine Landwirtschaft“ stellt er Überlegungen zu Eschenbachs Anfängen an und beschreibt im Detail die Bewirtschaftung von Pfarrgrund und Fischweihern, die Abgabe des Zehent und die einzelnen Grundstücke. Von den einst etwa 80 Weihern, die die Stadt im Lauf ihrer Geschichte besessen hat, sind ihr 17 geblieben. Was aus diesen Eschenbacher Weihern geworden ist und wo sie lagen, dieser Frage geht Ott in einem „Aufsatz“ nach und räumt ein: „Manches bleibt im Dunkeln.“ Er betont, dass die Fischwirtschaft bereits 1358 eine bedeutende Rolle gespielt haben muss, „sonst wäre im Wappen der Stadt nicht der Fisch erschienen“. In seinen tiefgreifenden Vorbemerkungen zu den Beschreibungen einer großen Anzahl von Weihern folgert er, dass „manche Weiher zumindest über die Flurbezeichnungen weiter existieren“ und verweist auf Böschungen in den Wäldern und auf durchlaufende Gräben. In ihnen sieht er Zeugnisse ehemaliger Weiher. Als Beweis dafür nennt er Weiher im „unteren Wald“, die im Standbuch von 1747 im Besitz der Stadt waren: Beerschmidtweiher, Rothweyer, Straßweiher, Seitenweiherl, das öde Weyerl, unterm roten Weiher, Gocksweyerl, Hummelweyerl und Urbanweyerl. Weil die Besitze des Klosters Speinshart an Eschenbacher Gebiet grenzen, befasst sich Ott auch mit den Weihern des Klosters.
Kindheitserinnerungen bei Pfeil und Bogen
„Der Friedhof ist nicht besonders gepflegt. Die Umtriebszeit für Erwachsene beträgt 15, für Kinder 7 – 8 Jahre. (…) Leichenhaus ist keines vorhanden, dagegen eine kleine Friedhofskapelle und ein Beinerhaus. Die Kindergräber sind zu nahe aufeinander und über kurz oder lang wird eine Friedhofserweiterung notwendig werden, welche keine Schwierigkeit bieten dürfte, da unmittelbar an den Friedhof eine Gemeindewiese stößt.“ Dieses Urteil Dr. Burgers aus dem Jahr 1909 nimmt Ott zum Anlass, sich auch mit der Erweiterung des Friedhofs und dem Bau des Leichenhauses zu befassen. Er vermittelt Einblicke über das Geschehen nach Todesfällen, geht auf die sich hinziehenden Bauplanungen ein und zeigt eine Bekanntmachung des Königlichen Landgerichts vom 19. Januar 1982 zum Verbot des Leichentrunkes.
Eingehend widmet sich Ott auch der Geschichte des 1949 gegründeten Brieftaubenvereins und kommt zu dem Schluss: „Wie lange Eschenbacher noch an Wettbewerben teilnehmen, wie lange der Verein überhaupt existieren wird, weiß niemand.“ Kindheitserinnerungen werden wach bei seiner Rückblende auf rivalisierende „Jugendbanden“ um 1960, die sich gar mit Pfeil und Bogen, Schleudern und Steinen bekämpften, Fische mit der bloßen Hand oder mit Pfeilen fingen, in Gemüsegärten auf Beutezug gingen und Katzen Blechdosen an den Schwanz banden.
Die kürzliche Ausstellung des Heimatvereins „Pillen, Pasten und Tinkturen – 200 Jahre Stadt-Apotheke Eschenbach“ und 30 Jahre Marienapotheke ruft Karlheinz Keck in einer Bildreportage in Erinnerung und schließt mit einem Zitat aus der „Schule der Pharmazie 1892“: „Scherze niemals mit den Kunden, denn in der Apotheke als einer nur menschlicher Not dienenden Anstalt ist jeder Scherz an und für sich unschicklich; am unschicklichsten und ganz unwürdig aber sind Scherze mit dem weiblichen Geschlecht oder unanständige Äußerungen irgendwelcher Art.“
Eine 14-seitige Laudatio widmet Bernd Thurn Otto Bogendörfer, dem Wegbereiter für das Gymnasium. Er beschreibt den besonderen Lebensweg des geborenen Fürthers, auf dessen Initiative es 1948 zur Gründung der Privaten Realschule unter Leitung von Edmund Langhans kam. Er verheimlicht nicht die Schwierigkeiten, die der Schule und ihrem Initiator bereitet wurden, sieht in ihm den „Vater der Schulstadt Eschenbach“ und hält es für überfällig, ihn „zumindest durch eine kleine Gedenktafel in der von ihm initiierten Schule posthum zu ehren“.
Wo es die Publikation zu kaufen gibt
- 113 Seiten und 136 Bilder hat das neue Werk des Heimatvereins mit dem Titel „Heimat Eschenbach 2020“.
- Anlaufstellen: Für neun Euro gibt es die Publikation in der Stadtapotheke Eschenbach, in der Buchhandlung Bodner in Pressath und nach Ende der Coronazeit beim Taubnschuster zu erwerben.







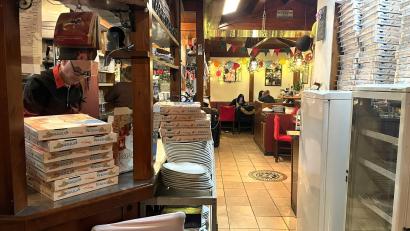










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.