Es ist schon viel publiziert worden über das Schloss in Brand bei Marktredwitz. Einen neuen Aspekt erörterten nun Architekt Gerhard Plaß und der Vorsitzende des markgräflichen Collegiums Historiae, Joachim Rohrer. Sie bezogen sich vor vielen Zuhörern auf die architektonische Entstehung des Ensembles. Weniger die Geschichtsdaten beherrschten die Informationen, vielmehr kamen auf Basis eigener Untersuchungen Fakten an den Tag, die bisher nur zum Teil bekannt waren.
Zur Arbeitsweise sagte Architekt Gerhard Plaß: „Der bauliche Zustand wird durch das Vermessen aller Ebenen bis in den letzten Winkel dokumentiert." Ergänzt würden die Zeichnungen durch Ansichten aus allen Himmelsrichtungen. Besonders wichtig seien die Schnitte durch die Gebäude und dreidimensionalen Darstellungen. Bei genauer Betrachtung der Grundrisse könne man aufgrund von Mauerstärken und Raumzuordnungen rückschließen auf das Baualter und die Abfolge von baulichen Veränderungen.
Zwei Keimzellen
Der Architekt kam zu dem Ergebnis, dass man innerhalb der beiden großen Baukörper des Schlosses mindestens zwei Keimzellen als ursprüngliche Schlossbauten ausmachen könne. Die Mauerstärke bis zu 1,50 Meter im Untergeschoss sei ein Hinweis auf versteckte Urbauten aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die erste Erwähnung von Brand ist in einer Urkunde des Klosters Waldsassen 1221 erfolgt. Das Rittergut und seine Fluren waren landwirtschaftlich geprägt, war zu hören. Scheunen, Ställe, Remisen und Nebengebäude seien nicht erhalten. Ein Brand 1690 zerstörte 21 Bauernhäuser, Schule, Kirche und „3 Schlösser“. Zwei der Schlösser ließen sich innerhalb der Gebäudestrukturen finden.
Verbunden mit der Entwicklung des Rittergutes sei die unmittelbar angrenzende Margarethenkirche. Die ehemalige Schlosskapelle entwickelte sich parallel. Der Schlossturm wurde erst nach 1890 als Bindeglied der beiden Schlossgebäude errichtet, 1911 erhöht, war zu erfahren. Die großen Veränderungen, An- und Umbauten und umfangreiche Ausstattungen im Innern gingen auf Albert Freiherr von Seckendorff zurück. Der Gestaltungswille des Vizeadmirals präge bis heute das Erscheinungsbild des Schlosses.
Bedeutende Stellung
Der frühere „Hausherr“ Joachim Rohrer – heute ist das Schloss im Besitz der Stadt Marktredwitz - erinnerte an den Musiker und Komponisten Jobst von Brandt. Er habe im Kloster Waldsassen gedient und sei Mitglied der fünf Heidelberger Liedmeister gewesen. Joachim Rohrer unterstrich die Bedeutung des Rittergutes, das sich in die zahlreichen Burgen der Umgebung einordnete und als Schnittpunkt von Ost und West und Nord und Süd eine besondere Stellung erreicht gehabt hätte.
Erwähnt wurde auch die Brauerei. Untersuchungen hatten unter dem Areal eine große Kellerwelt ergeben, die aber noch nicht ganz erschlossen sei. Schließlich wurde noch die Nutzung während des Zweiten Weltkriegs angesprochen. Unter anderem die Arbeitsgemeinschaft für Kernphysik habe viele Umbauten veranlasst, was bis heute Rätsel aufgebe. Der Nobelpreisträger Otto Hahn habe sich wohl mehrfach in Brand aufgehalten. Ein Labor habe noch bis 1968 im Schloss bestanden.


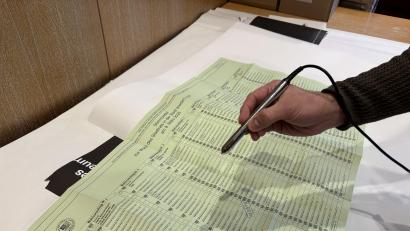












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.