Heinrich Berr nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Fernwärmepreise geht. Der promovierte Ökonom aus Guteneck hat sich vor zwei Jahren die "brutale Rechnung" für seine Weimar-Werk GmbH in Thüringen ganz genau angeschaut. "Bis man kapiert, was dahinter steckt, braucht man fast ein Jahr", seufzt der 63-Jährige, der längst Konsequenzen gezogen hat und mit seinem Protest die Medien auf sich aufmerksam gemacht hat, zuletzt im Fernsehen beim ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus". Der Sender hatte von einer Rentnerin berichtet, die 8000 Euro für Fernwärme nachzahlen muss – und eben auch von dem Unternehmer, der die intransparente Preisgestaltung in der Branche mit Monopol-Stellung kritisiert.
"Wir sind Stahlbauer", erklärt Berr. Seit neun Jahren ist er geschäftsführender Gesellschafter der Weimar-Werk GmbH und hat mit der Edelstahl Weimar GmbH noch ein weiteres Werk in Mechelroda. 50 Mitarbeiter fertigen in Weimar Stahlbaukonstruktionen für die Automobilbranche, die Getränke- und die Pharmaindustrie. Jahrzehntelang wurden die großen Werkshallen mit Fernwärme von den Stadtwerken Weimar beheizt – bis der Preis für die Kilowattstunde regelrecht explodierte: Von 3,3 Cent (netto) im Winter 2020 stieg der Arbeitspreis auf 51,9 Cent im Winter 2022. "Das ist mehr als das 15-Fache", verdeutlicht der 63-Jährige und klagt über lokale Monopolisten, die sich nicht in die Karten schauen lassen.
Die Reißleine gezogen
Sein Unternehmen hat längst die Reißleine gezogen, nur einen Teil der Rechnung bezahlt und den Winter mit einer mobilen Ölheizung überbrückt. Jetzt liegt der Fall vor Gericht. Die Stadtwerke Weimar pochen auf die ausstehenden 50.000 Euro, das Werk wehrt sich gegen diese Forderung auf Basis der Unwirksamkeit der Fernwärme-Preisanpassungsklausel zum Arbeitspreis. Was das genau bedeutet, ist höchst kompliziert. "Jedes Stadtwerk macht sich da zur Berechnung seine eigene Formel, da gibt es einen extremen Spielraum", so der Unternehmer. Eine Rolle spielt dabei der Gaspreis, der Wert orientiert sich an einem – keineswegs einheitlichen – Börsen-Index. Wie problematisch das sein kann, sei in Weimar lange nicht aufgefallen, weil der Gaspreis jahrelang relativ konstant war. Doch das hat sich geändert. Laut "Plusminus" hat die Fernwärme-Rechnung beim Weimar-Werk in einem Monat 100.000 Euro verschlungen, ein Drittel des monatlichen Umsatzes. "Und anders als bei Gas oder Strom gibt es bei solchen Änderungen kein Sonderkündigungsrecht", erklärt Berr, für den Fernwärme bei diesen Bedingungen ganz schnell unbezahlbar wurde.
Dabei ist Berrs stahlverarbeitendes Werk noch nicht einmal so energieintensiv wie der Hersteller-Sektor. "Wir haben sehr viel Energie eingespart, aber 400 Kilowatt brauchen wir mindestens", sagt der 63-Jährige, der nun nach der Übergangslösung mit der mobilen Ölheizung auf der Suche nach einer Alternative ist, die Sinn macht. Die Wärmepreisbremse habe 2023 schließlich auch nur dazu geführt, dass letztlich indirekt der Steuerzahler die exorbitanten Preissteigerungen tragen musste. "Aber da gibt es keine vernünftige Lösung", seufzt der Geschäftsführer. Die Empfehlung von Energieberatern und Heizungsbauern geht Richtung Gas-Brennwert-Kessel, für eine Wärmepumpe sei der Energiebedarf zu groß.
Knackpunkt Wirkungsgrad
Was die Fernwärme und ihre Rolle in der Energiewende betrifft, bleibt Berr eher skeptisch. "Nirgendwo findet sich eine Zahl zum Gesamtwirkungsgrad von Fernwärme.", bedauert er. In Weimar, wo die mit Gas betriebene Anlage der Stadtwerke gerade mal drei Jahre alt ist und die Leitungen relativ kurz sind, liege der Wirkungsgrad bei 62 Prozent. "Das heißt 38 Prozent fossiler Energie verschwinden im Boden oder im Universum - wie soll Fernwärme da Sinn machen?", rechnet der Geschäftsführer vor. "Kommunale Wärmepläne füttern lediglich einige Beratungsunternehmen, bringen am Ende aber keine praktischen Ergebnisse", so seine Überzeugung. Die Ausnahme: Wenn Fernwärme wie beispielsweise im Schwandorfer Müllkraftwerk, quasi als "Abfallprodukt" genutzt wird, geht die Rechnung schon eher auf. Und die aktuellen Preise dort (ab April 2024 Arbeitspreis 6,536 Cent netto pro Kilowattstunde; Vorjahr 6,02 Cent netto) sind laut Berr im Städtevergleich auch in Ordnung.
"Bei 80 Prozent der Anbieter sind die Preise seriös", denkt der Unternehmer über die Kalkulation. Zehn Prozent der Fernwärme-Lieferanten können seiner Einschätzung nach erstaunlich günstig anbieten, weil sie gut "eingekauft" haben, die übrigen zehn Prozent hätten entweder schlecht eingekauft – oder satte Übergewinne eingestrichen. Um mehr Licht in das Dunkel der Preisgestaltung zu bringen, haben Heinrich Berr und sein Sohn und Mitgesellschafter Ferdinand Berr inzwischen eine Internetseite ins Leben gerufen, die den Fernwärmepreis und auch den "Fall Weimar" thematisiert. "Wir kämpfen da nicht nur für uns", argumentiert der Ökonom, "da hängen sich auch andere mit ran". Nicht zuletzt das Bundeskartellamt, das laut Berr inzwischen gegen sechs Stadtwerke ermittelt.
So wird der Preis für Fernwärme errechnet
- Kalkulation: aus Grundpreis (Investition, Personal, Fixkosten) und Arbeitspreis (abhängig vom Verbrauch und der Energiequelle/Brennstoff)
- Preisanpassung: erforderlich durch den Arbeitspreis; erfolgt über mathematische Formeln, dabei wird die Situation am gesamten Heiz- und Wärmemarkt berücksichtigt (Kombination aus Kosten und Marktelement)
- Formel: wie sich verschiedene Indizes und Gewichtungen in der Preisformel auf den Arbeitspreis auswirken, lässt sich auf einer von Heinrich Berr erstellten Internetseite (fernwaerme-preis.de) ausprobieren
- Preisvergleich: Höchststand im vierten Quartal 2022 in Weimar bei 51,9 Cent pro Kilowattstunde netto (deutscher Arbeitspreis zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt bei 9,3 Cent).


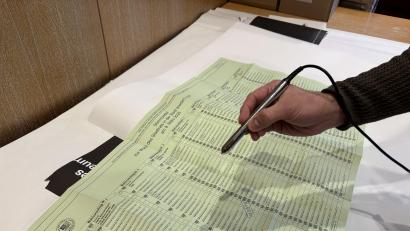












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.