Trotzdem begann Baumeister Emmeram Grundler aus Waidhaus erst 1766 mit dem Turmbau. Grundler bemühte sich, den Turm meistertüchtig und solid zu bauen. Er hielt sich an die Kostenvoranschläge und endlich 1769, also vor genau 250 Jahren, war der prächtige Zwiebelturm fertig.
Als 1746 die Wallfahrt zur Wies in einer alten Feldkapelle, auf dem Platz der heutigen Kirche, entstand, und der gleich anfänglich große Zulauf sich ständig mehrte und viel Opfergeld einging, suchte der Magistrat das Recht der Verwaltung über die Feldkapelle (sie war Vorgänger der Wieskirche) zu beanspruchen. Mit dem Baubeginn für die neue Wallfahrtskirche im Juni 1748 verschärfte sich dieser Streit. Der damalige Pfarrer Schmelzer setzte gegen das Moosbacher Ansinnen alle Hebel in Bewegung. Der Grund, auf dem die alte Feldkapelle stand, und die neue Kirche zu stehen kommt, so berichtete er an das Ordinariat in Regensburg, war schon immer Eigentum der Pfarrstiftung. Die Dorfgemeinde von Grub hatte auf dem Grundstück schon immer das Recht zum „Blumenbesuch“, also das Recht das Vieh zu hüten. Die Leute von Heumaden, Gebhardsreuth, Grub und Ödhöflern dürfen ihre Leichen bis zu der Kapelle tragen und absetzen, wo sie dann vom Pfarrer übernommen und in den Friedhof geleitet werden, berichtete der Moosbacher Pfarrer weiter.
Im Interesse der Wallfahrt und des Markts wäre es nun am besten gewesen, die Angelegenheit als beendet anzusehen. Leider war das nicht der Fall. Am 19. Juni 1748 war die Grundsteinlegung für die Wallfahrtskirche. Vier Tage danach verlangte Moosbach vom Pfleger in Treswitz die Bestätigung der Jurisdiktion, also der Hoheitsrechte über die Wieskirche. Am 23. Juli 1748 forderte die Regierung Moosbach auf, alles „beim alten zu belassen“, andernfalls die 1608 beziehungsweise 1710 erteilten Freiheiten und Privilegien aufgehoben werden. Sicherheitshalber verlangte die Regierung aber ein „innehalten“ der Bauarbeiten. Der Pfleger in Treswitz hielt sich nicht daran. Nun eskalierte der Streit, denn der Moosbacher Rat übernahm selbst die Baueinstellung. „Der Magistrat und Bürgermeister Johann Feyhl rückten mit ihren Bürgern, bewaffnet mit Flinten, an und trieben nicht nur die Maurer und Zimmerleute weg, sondern nahmen das Werkzeug fort und ließen die Sandgräber in Eisen und Banden schlagen“, berichtete Pfarrer Engelbert Seidl in seiner Chronik, die 1905 erschien.
„Feyhl stellte die Arbeiten ein und die Baumaterialen und Baugeräte wurden nach Moosbach geschleppt, zum Entsetzen der Frommen besonders der fremden Wallfahrer“. Der Pfleger Franz Ferdinand Reisner von Lichtenstern berichtete erbost zur Regierung nach Amberg: „Der Name des Bürgermeisters Feyhl verdient gebrandmarkt zu werden. Er allein war schuld an den aufrührerischen Vorgängen; er forderte auf zum Aufruhr; er bestrafte sogar die, die sich nicht mit Gewehr und Waffen einfanden und verhetzte die Bürger so, dass sie äußerten, Leib und Leben daran zu setzen, um ihr vermeintliches Recht zu erkämpfen. „Dieser Feyhl zog früher mit einem Glückhafen und verbotenen Spielen im Lande umher; von Beruf war er Schneider“, machte ihn der Pfleger bei der Obrigkeit schlecht.
Am 2. September 1748 wurde die Baueinstellung wieder aufgehoben. Dem Marktrat wurde befohlen, sich aller Tätlichkeiten zu enthalten, nötigenfalls die Garnison zur Entsendung der benötigten Mannschaften angehalten werde. Nun trat endlich wieder Ruhe ein und die Wallfahrtskirche konnte 1752 vollendet werden. Der Streit um die Jurisdiktion aber war noch lange nicht beendet. Die Regierung suchte eine einvernehmliche Lösung. Eine Kommission, der zwei vom Marktrat gewählte Kirchenpröpste angehören, sollte bis zum Ende der Streitigkeiten die Opfergelder verwalten. Die Schlüssel für den Opfergeldschrein sollten auf Kirche, Pflegeamt und Markt entsprechend aufgeteilt werden. Die Regierung wies den Pfleger am 12. November 1756 an, die Abzählung der Opfergelder unter Beiziehung der Marktdeputierten durchzuführen.
Dazu kam es wiederum nicht, denn der Pfleger verweigerte sich, das wegen Mangel jeglichen Rechts des Magistrats zu tun. Noch einmal am 31. März 1758 versuchte der Magistrat Recht zu bekommen. Stattdessen wurde aber am 15 Januar 1759 befohlen, nach Amberg zu kommen und die Urheber der seinerzeitigen Unruhen mitzubringen, damit diese ihre Strafe empfangen. Der Marktrat ersuchte um Aufschub, weil einige der Vorgeladenen durch Krankheit oder Abwesenheit am Erscheinen verhindert wären. Ein Aufschub wurde nicht gewährt, wer kommen kann muss kommen, so hieß es. So stolz der Streit begonnen, so ruhmlos endete er. Weh- und demütig war das Bittgesuch der Schuldigen, nicht nach Amberg gehen zu müssen. Sie fürchteten die schon lange angedrohte Strafe; sie hätten aus Unwissenheit das Strafbare getan und der Fürst möge in seiner Güte ihnen eine Geldstrafe auferlegen, die sie als Opfer für die neuerbaute Kapelle geben wollten. Von den Schuldigen fuhr keiner nach Amberg. Vom Magistrat erschienen Georg Peter Kemnitzer, Sebastian Lorenz und Advokat Pleyer. Am 18. Februar 1758 wurde entschieden: die Verwaltung der Wieskirche hat das Pflegeamt Treswitz und nicht der Markt Moosbach; der Markt trägt alle Verfahrenskosten; die Schuldigen wurden zu erträglichen Geldstrafen verurteilt. Damit war der Streit nach elf Jahren für Amberg und Treswitz beendet. Dies wurde aber versehentlich nicht der Hofratskammer in München mitgeteilt. Dort „schlummerten“ die Akten mehr als 30 Jahre. Am 16. Dezember 1789 erfolgte der Bericht der Regierung von Amberg nach München, die daraufhin die Akten für immer schloss.












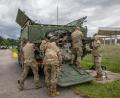



Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.