Das Raketenschießen ins neue Jahr ist eigentlich ein neuzeitlicher Brauch. Zwar machte man schon im Mittelalter mit allen möglichen Dingen Lärm, um in dieser Raunacht böse Geister zu vertreiben, so dass im neuen Jahr Glück einkehre. Doch erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts war es durch die Massenproduktion für jedermann möglich, sein eigenes Feuerwerk zu veranstalten, nun weniger zur Dämonenabwehr, sondern eher zur Gaudi.
Die Corona-Pandemie ist heuer schuld daran, dass kaum Raketen abgeschossen werden dürfen und auch an Silvester eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gilt. Das war das letzte Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall. Dafür gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen. In Pirk erinnern sich daran Josef Götz und Johann Kammerer sowie der gebürtige Schirmitzer Willi Lanzl und der Ex-Moosloher Hans Reis. Angesichts der Ursache dieses 75 Jahre zurückliegenden Ereignisses erscheinen im Vergleich die diesjährige Ausgangssperre und das Verkaufsverbot von Feuerwerk als weniger einschneidende Maßnahmen.
1945 hatte die amerikanische Militärregierung eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang angeordnet, die eigentlich auch für den Silvestertag galt, den ersten friedlichen Jahreswechsel nach sechs Jahren. In der Münchner Stadtchronik ist allerdings vermerkt, dass für die Silvesternacht eine Erleichterung gewährt und die Sperrzeit auf zwei Stunden von 3 bis 5 Uhr früh bemessen wurde.
Eventuell war das aber nur für Großstädte gedacht. Jedenfalls ist es den Pirker Senioren nicht bekannt. In einer Zeit, in der die meisten Familien Angehörige als Kriegsopfer zu beklagen hatten, auf ein Lebenszeichen von Vermissten warteten oder Väter und Söhne erst nach Gefangenschaft heimkehrten, in einer Zeit, in der Armut und Not herrschten, Lebensmittel und Brennmaterial knapp waren und dazu der Jahreswechsel mit einem eisigen Neujahrsmontag verbunden war, sehnte sich niemand nach Silvesterknallerei.
Die Menschen hatten, so Willi Lanzl, andere Sorgen und mussten in den Jahren zuvor genug "Feuerwerk" mit Sirenengeheul und Bomberangriffen über sich ergehen lassen. Hans Reis erzählte, als Neunjähriger selbst ein "Kracherl" für Silvester gebastelt zu haben: Zwei Schrauben, an denen ein längeres Stück Schnur befestigt war, wurden durch eine größere, mit von einem Streichholz abgeschabten Schwefel gefüllten Mutter zusammengefügt und gegen eine Mauer geschlagen - eine nicht ganz ungefährliche Sache. Silvester war damals ein Tag wie jeder andere, an dem man früh ins Bett ging - schon weil es da einigermaßen warm war.
Es gab weder Punsch oder Kaffee als Getränk, höchstens "Muckefuck" aus gerösteter Gerste. Silvestermenü waren gekochte und geschmalzene Erdäpfel. Erst nach der Währungsreform und dem Beginn der 1950er Jahre ging es allmählich wieder aufwärts.
Etliche Traditionen haben sich die Jahrzehnte über mehr oder weniger bis in die heutige Zeit erhalten. Dazu gehört das Bleigießen, bei dem ein Stück Blei in einem Metall-Löffel über einer Kerze erhitzt, verflüssigt und in kaltes Wasser gekippt wird. Die abrupt abgekühlten und erhärteten Figuren werden interpretiert und als Blick in die Zukunft gedeutet. Hans Reis weiß noch, dass es sein recht christlicher Vater nicht duldete.
Seit 2018 ist der Vertrieb der Rohlinge, die bis 71 Prozent Bleigehalt hatten, verboten, so dass sie durch Produkte mit 0,3 Prozent oder durch Kerzenwachs ersetzt wurden. Zum Schutz des Hauses, seiner Bewohner und der Haustiere wurde besonders in Landwirtschaftsbetrieben am Silvesterabend "ausgeräuchert": Glut aus dem Ofen, bestreut mit Weihrauchkörnern, trug man auf einer Kehrschaufel durch alle Räume und Ställe.
Johann Kammerer und Josef Götz erinnern sich an den alljährlichen Silvestertanz des SPD-Ortsvereins im alten "Beck'n-Saal", bei dem es schon mal beim "Ausbieter"-Tanz, den ein einzelnes Paar für sich gegen eine Runde "Klare" bei der Musikkapelle bestellen konnte, zu Rangeleien und Raufereien kam. Schon vor dem Neujahrstag wünscht man sich auch heute noch "an guadn Rutsch", möglicherweise abgeleitet vom Jiddischen "Gut Rosch" (guten Anfang); an Neujahr selbst bei Begegnungen auf der Straße und dann bei Verwandtenbesuchen "a guads Nais", heuer wieder einmal nötiger denn je.















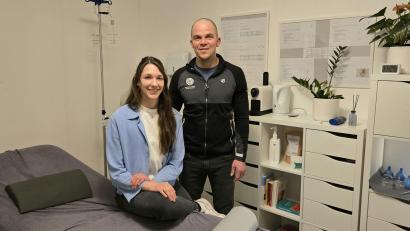






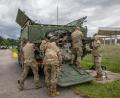

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.