Viele Besucher hörten sich den Vortrag des Kommunikationswissenschaftlers im Seidel-Saal an. Stadtheimatpfleger Markus Lommer und Karl-Heinz Keil von der Hanns-Seidel-Stiftung freuten sich über das hohe Interesse. Besucher reisten sogar bis von Bayreuth aus an. Vor dem Vortrag brach Haller eine Lanze für den Seidel-Saal: "Der Seidel-Saal ist als kultureller und wissenschaftlicher Begegnungsort von überragender Bedeutung. Von meiner Seite aus gibt es ein klares 'Daumen hoch' - die Einrichtung hat meine volle Unterstützung."
Gegen die Bevölkerung
Der Sulzbach-Rosenberger erklärte zunächst Grundlagen der politischen Kommunikation von EU-Gegnern. Kampagnen gegen die EU seien meist mit fundamentaler Kritik an Eliten verbunden. EU-Kritiker richteten ihre Appelle an die eigene Bevölkerung, als Gegenpol zu etablierten Strukturen.
"Dies ist im Grunde eine illiberale Position. Schließlich gibt es 'die Eliten' und 'die Bevölkerung' nicht als homogene Einheiten. Daher kann es auch keine Interessen geben, die alle Gruppen miteinander teilen und von EU-Kritikern kommuniziert werden. Wenn Politiker also von der Bevölkerungsmeinung sprechen, unterschlagen sie damit meist Interessen von Minderheiten", so Haller. Anhand der Brexit-Kampagne erklärte der Forscher anschaulich, wie Parteien diese Strategie in der Praxis umsetzen. Die Kampagne der Brexit-Befürworter stützte sich etwa auf die Behauptung, dass die Briten jede Woche 350 Millionen Pfund an die EU überweisen würden. Tatsächlich gab es von der Brexit-Kampagne keine Aussage darüber, wieviel Geld im Gegenzug nach Großbritannien fließt.
Gefährliches Facebook
"Gefährlicher als Plakate waren in der Brexit-Kampagne aber Werbeanzeigen in Facebook und anderen Social-Media-Angeboten. Die Kampagne spielte diese Anzeigen gezielt an bestimmte Bevölkerungsgruppen aus und bediente mit deren Ängste."
Fake News, also Desinformation im Internet, verbunden mit automatisierter Verbreitung, könnten in bestimmten Fällen Medienwirkung entfachen. Haller präsentierte eine Studie, die nachwies, dass Befürworter einer Partei Fake News unter bestimmten Umständen eher glauben als Anhänger der gegnerischen Partei. Das könne zu Mobilisierungseffekten führen, die in Mehrheitswahlsystemen wichtige Stimmen zum Wahlsieg bringen.
Der Kampf gegen Fake News sei dabei gleichzeitig ein Wettlauf von Technologien. Neue Programme seien in der Lage, Videoaufnahmen und Tonspuren von Politikern zu verfälschen. "Jemand mit bösen Absichten könnte einen Politiker diskreditieren, indem er ihm Dinge sagen lässt, die er nie gesagt hat", warnte Haller. Er rät, dubiose Meldungen genaus zu prüfen und gegebenenfalls Ratgeberseiten im Internet wie mimikama.at zu besuchen.
Der Kommunikationsforscher zeigte zwei mögliche Säulen einer Lösung gegen Desinformation und Anti-EU-Stimmung auf: Um EU-Gegnern thematisch entgegenzuwirken sei eine stärkere Überwachung von politischen Problemfeldern nötig. Es gehe darum, Probleme bereits in der Entstehung zu erkennen. Hierzu empfiehlt Haller die Einbindung von externen Experten. "Die Ergebnisse müssen dann aber auch von Politikern und Beamten angenommen und bearbeitet werden. Das Beispiel Eurokrise zeigt, dass frühe Warnungen aus der Wissenschaft schlichtweg nicht beachtet oder bewusst ignoriert wurden", kritisierte der Dozent.
Die zweite Lösungsstrategie sieht Haller in einer massiven Stärkung von Medienbildung, die er als "Media and Communication Literacy", also Medien- und Kommunikationsalphabetisierung, sieht. Anhand eines Modells, das er mit Prof. Markus Kaiser (TH Nürnberg) jüngst bei einer Konferenz in Montreal vorstellte, zeigte er diesen Weg genauer auf.
Kernen durch Planspiele
Bereits im Grundschulalter müssten Kinder lernen, wie Journalismus funktioniert und was echte Quellen ausmacht. "Dies kann spielerisch geschehen, zum Beispiel durch Planspiele, in denen die Schüler in die Rolle von Zeitungsredakteuren schlüpfen", erklärte Haller eine praktische Umsetzung, die bereits erprobt wurde. In weiterführenden Schulen und in der Erwachsenenbildung sollten tiefergehende Themen wie Quellenkritik und Theorie und Praxis von Algorithmen Thema sein.
Die Arbeit von Erwachsenenbildungswerken, Stiftungen und anderer Bildungsträger in der Medien-Alphabetisierung sei dabei von entscheidender Bedeutung. Dass Bildungsangebote wie der Vortragsabend der Hanns-Seidel-Stiftung auf Nachfrage treffen, zeigte sich: Die Besucher diskutierten noch lange mit dem Referenten über mögliche Lösungen gegen Desinformation und falsche Stimmungsmache.
Die Teilnehmer sprachen darüber, welche Rolle Schulen in der Digitalisierung spielen sollen und können. "Fakt ist, dass die Politik mehr Geld für digitale Bildung in die Hand nehmen muss, um, Heranwachsende über Problemfelder aufzuklären", schloss Haller.
Dr. André Haller forscht und lehrt an der Universität Bamberg am Institut für Kommunikationswissenschaft. Seine Schwerpunkte sind strategische und politische Kommunikation (insbesondere in digitalen Umwelten und in Wahlkampfzeiten), die kommunikationswissenschaftliche Erforschung von Skandalen und neue Entwicklungen im Journalismus. Nach dem Abitur am Herzog-Christian-August Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg studierte er zunächst an der Universität Passau, bevor er seinen Master und Doktorabschluss an der Universität Bamberg erlangte. Seine Studien werden international veröffentlicht und er war bereits als Experte im Deutschlandfunk, Sat.1, Al Jazeera, ORF und zahlreichen regionalen Medien eingeladen.

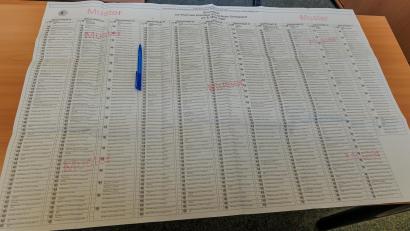












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.