Das Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 stand im Mittelpunkt der Gedenkfeier in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg. Die örtliche SPD hatte zu der Veranstaltung eingeladen, umrahmt mit Gitarrenmusik von Andreas Fischer. Fraktionsvorsitzender Joachim Bender appellierte auch angesichts der „menschenverachtenden Politik der AfD“ den Geflüchteten gegenüber, dass sich diese Ereignisse niemals wiederholen dürften. Jüdische Bürger hätten die Stadt geprägt, erinnerte Erster Bürgermeister Stefan Frank. Mutiger Widerspruch sei immer noch gefragt, das „Nie wieder“ sei der tägliche Auftrag.
Rednerin Bettina Moser sprang für den erkrankten Altbürgermeister Gerd Geismann ein und bediente sich einiger Zitate von Altbundeskanzler Helmut Schmidt aus dessen Rede von 1978 zur Reichspogromnacht. „Wir stehen heute hier, um zu gedenken – einer Nacht, die man früher beschönigend Kristallnacht nannte, die aber in Wahrheit der Beginn des offenen Terrors gegen die Juden in Deutschland war: die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, in der das Licht der Menschlichkeit fast erlosch.“ Damals wurden in Deutschland und Österreich 267 Synagogen niedergebrannt, tausende Geschäfte und Wohnungen jüdischer Familien verwüstet, rund 40.000 Menschen verhaftet, 91 ermordet.
Beginn des Terrors
„Sulzbach-Rosenberg wurde in dieser Nacht verschont, weil die hier lebenden Juden bereits 1936 alle die Stadt verlassen hatten. Die Synagoge wurde damals schon als Heimatmuseum genutzt“, berichtete Bettina Moser. Schmidt habe es klar benannt: „Es begann die sogenannte Endlösung der Judenfrage.“ Viele Deutsche sahen zu, manche billigten, viele schwiegen. Die Kirchen, die es besser hätten wissen müssen, schwiegen ebenfalls. „Obwohl Kirchen wie Synagogen demselben Gott dienen“, sagte Schmidt damals – ein Satz, der bis heute nachhallt.
Helmut Schmidt fand den Grund in einer mangelhaften demokratischen Erziehung und erkannte: „Die Generation von 1918 hatte eine Demokratie geerbt, ohne sie wirklich verstanden zu haben.“ Viele suchten Sündenböcke. „Die Flucht in den Hass fand ihre Ziele: Demokraten, Gewerkschafter, Künstler, Gelehrte, Bekenner insgesamt – sie alle trieb man ins Exil oder ins Konzentrationslager. In den Juden aber traf man die Aufklärung und die freiheitliche Emanzipation im Kern.“
Demokratie verteidigen
Moser zitierte die Warnung Schmidts, aus der Vergangenheit nur Trauer zu ziehen. Die Konsequenzen lauteten bis heute: Demokratie muss gelernt, verteidigt und gelebt werden. „Die heute lebenden Deutschen sind als Personen zu allermeist unschuldig. Aber wir haben die politische Erbschaft der Schuldigen zu tragen und aus ihr die Konsequenzen zu ziehen.“ Schuld sei nicht erblich, Verantwortung schon.
Die Lehren für heute legte Moser auch fest: „Wir leben in einer Zeit, in der Wahrheit, Würde und Verantwortung wieder umkämpft sind. In der Lügen über soziale Medien millionenfach verbreitet werden und alte Feindbilder neue Formen annehmen: gegen Juden, Muslime, Migranten, politische Gegner. Die Mechanismen sind dieselben wie damals.“ Helmut Schmidts Warnung klinge aktueller denn je: „Mit der Suche nach Sündenböcken hat es angefangen. Mit Gewalt gegen Schriften und Bücher und gegen Schaufenster hat es sich fortgesetzt. Die Gewalt gegen Menschen war dann nur noch die vorbereitete Konsequenz.“ Darum sei Bildung unsere wichtigste Waffe gegen das Vergessen.
„Uns steht es nicht an, die Juden der Welt zur Versöhnung aufzurufen. Wohl aber dürfen wir um Versöhnung bitten“, formulierte Schmidt damals: „Wir sind stolz auf unseren Staat, unsere offene Gesellschaft und deren Traditionen. Es ist der gerechteste Staat, den es bisher in der deutschen Geschichte gegeben hat.“ Tradition bewahren heiße nicht, Asche aufheben, sondern eine Fackel am Brennen erhalten - die Liebe zum Menschen, die Achtung vor der Würde jedes Einzelnen, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. „Lassen wir es nie wieder so weit kommen. Lassen wir uns leiten von Menschlichkeit, Verantwortung und Mut.“


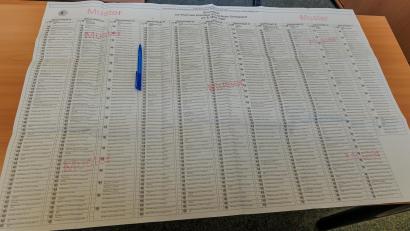












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.