Der Zweite Weltkrieg ist längst verloren, als die Front sich im Frühjahr 1945 der Oberpfalz nähert. Offen ist allenfalls noch die Frage, ob die Amerikaner von Franken oder die Russen von Böhmen her in unsere Region vorstoßen. Die Deutsche Wehrmacht und die Waffen-SS sind gezwungen zurückzuweichen und versuchen, an der Donau eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Trotzdem gibt es auch in der Oberpfalz noch kleinere militärische Einheiten („Werwolf“) und NS-Partei-Anhänger, die an den „Endsieg“ und den „Einsatz der Wunderwaffen“ glauben, als im April 1945 die 3. US-Army in das Herzstück des „Gaues Bayerische Ostmark" vorrückt. Noch bevor das „Großdeutsche Reich“ aufhört zu existieren (8./9. Mai 1945), besetzen Teile der 11. US-Panzerdivision des XII. US-Armeekorps – nach eingeleiteter Beschießung und Tieffliegerangriffen vom 21. April 1945 – am 22. April 1945 die Max-Reger-Stadt.
Interessant ist es, dass es neben den zahlreichen historischen Quellen auch einige literarische gibt. Sie machen es Interessierten leichter, diese brisante Zeit nachzuvollziehen und zu begreifen.
Weiden, die alte Eisenbahnerstadt ist in jener Zeit ein wichtiger Knotenpunkt für Soldatentransporte, Lazarettzüge, Kinderlandverschickung, Flüchtlingszüge aus den deutschen Ostgebieten und – KZ-Transporte. Letztere gingen ins KZ Flossenbürg bzw. nach Hersbruck. Der Österreicher Max Wittmann („Weltreise nach Dachau. Ein Tatsachenroman“, 1947) und der spätere ungarische Verleger Geza Berey („Hitler-Allee“, o. J.) schildern eindrucksvoll ihre Ankünfte: „Vor einer Station treiben uns die Wächter in den Graben neben den Eisenbahnschienen. Die Stadt vor uns ist Weiden ...“
Bernhard M. Baron
Von 1984 bis zu seinem Ruhestand 2007 leitete der gebürtige Luher Bernhard M. Baron das Kulturamt der Stadt Weiden. Gleich im ersten Jahr rief er die Weidener Sommerserenaden ins Leben, schon 1985 ließ er die Weidener Literaturtage folgen. Der heute 72-Jährige verfasste "Weiden in der Literaturgeographie", eine detaillierte Übersicht über die Erwähnungen der Stadt in der Literatur. Zudem schreibt er für das "Literaturportal Bayern". Seit 2019 lebt er in Niederbayern.
Im September 1944 kommt der spätere namhafte sozialkritische Schriftsteller („Wir Untertanen“, „Die Laufmasche“) und Schriftsteller-Präsident Bernt Engelmann (1921 – 1994) ins Landgerichtsgefängnis Weiden (dem historischen Waldsassener Kasten), bevor er später ins KZ Flossenbürg eingeliefert wird. Seine eindrucksvollen Erlebnisse enthält seine Biographie „Bis alles in Scherben fällt. Wie wir die Nazizeit erlebten. 1939 – 1945“ (1983): „Am 22. September ging es über Bayreuth weiter nach Weiden in der Oberpfalz. Wir hörten, dass Russen Reval erobert und der deutschen Armee den Rückweg abgeschnitten hatten. Die dünne Suppe im Weidener Gefängnis war unsere Henkermahlzeit…“ Bernt Engelmann wollte den „Gefängnisort Weiden“ nie wiedersehen. Es dauert vier Jahrzehnte. Bei den 1. Weidener Literaturtagen „1945 – Wie war das eigentlich?“ übernimmt Bernt Engelmann die erste öffentliche Lesung am 3. Mai 1985 im Kulturzentrum Bauer.
Auch der „Feldflugplatz Maierhof“ (Ullersricht) taucht in der Literatur, im heroisierenden Kriegsroman „Stuka“ (1965), des Österreichers Valentin Mikula auf, als im Dezember 1944 „Bordfunker und vierzig Flugschüler“ nach Weiden versetzt werden: „In Weiden gab es ein riesiges Hallo. In einem nahen Gasthof gab es fantastische Dampfnudeln um wenige Marken, am Platz wurde mit Segelflugzeugen geschult ...“ Schon der spätere Dokumenta-Professor Joseph Beuys hatte sich in den 40er Jahren hier ein kurzes Stelldichein als Stuka-Bordfunker gegeben und kommt Jahre später – der Kunstfreundschaft zu einem Weidener HNO-Arztes wegen – wieder zu einem Spontanbesuch nach Weiden.
In das „Landgerichtsgefängnis Weiden“ wird – in der Novelle „Auferstanden“ (1948) des prominenten Berliner Schriftstellers und UFA-Drehbuchautors („Die Mädels vom Immenhof“,„Canaris“) Erich Ebermayer (1900-1970) mit Wohnsitz Schloss Kaibitz bei Kemnath – der „Deserteur Klaus Eberhard von Platen vom Wehrmachtsgefängnis Küstrin verlagert“. Der Roman, angesiedelt „in der nordbayerischen Stadt W.“, berührt literarisch auch das große Eisenbahn-Munitionsunglück vom 16. April 1945: „Auch dass heute morgen ein Munitionszug bei der Einfahrt in den Bahnhof getroffen und in die Luft geflogen sei, sickerte durch. Über die Front war nichts zu erfahren.“ Dem aristokratischen Wehrmachts-Gefangenen gelingt nach „Tieffliegerangriffen“ und der Rede „von angeblich starken SS-Einheiten" im Raum Grafenwöhr die Flucht in eine benachbarte Gärtnerei. Wegen seiner Verletzung muss er in ein Lazarett, in ein „schauerlich überhitztes Klassenzimmer der Tertia des Gymnasiums“ (das heutige Augustinus-Gymnasium). An einem Oktobermorgen 1945 nimmt der Roman-Protagonist „Abschied“ von „der Stadt W.“
Sandra Paretti (alias Irmgard Schneeberger, 1935-1994), die Grande Dame der bundesdeutschen Unterhaltungsliteratur („Der Winter, der ein Sommer war“, „Der Wunschbaum“), erinnert sich in ihrer Mutter-Hommage „Das Echo Deiner Stimme“ (1980, Neuauflage 1998) eindrucksvoll-stimmungsgewaltig an Ihre Kindheit in Weiden. Im Herbst 1944 kommt sie mit ihrer Mutter Maria und ihrem Bruder Karl – Vater Clemens ist bereits zur Wehrmacht eingezogen – infolge der verschärften Kriegslage in Regensburg und der Entbindung ihrer Mutter (am 11. Juli 1944 ist Bruder Helmut geboren) mit der Eisenbahn schutzsuchend nach Weiden zu ihren Großeltern. Der Großvater war technischer Direktor der Weidener Porzellanfabrik Bauscher. In der Villa der Großeltern am Reiterweg erlebt sie am 22. April 1945 die Besetzung Weidens durch die US-Army: „Die Amerikaner kommen an einem strahlenden Tag. Zuerst die Tiefflieger; sie kreisen so niedrig, dass man die Piloten in der Kanzel sieht. Dann die Panzer; langsam rollen sie durch das halbhohe Weizenfeld vor unserem Garten, nehmen fast den Zaun mit, überqueren die Straße und verschwinden in den Naabwiesen. Zuletzt die Jeeps und die Motorräder. Auf dem Weizenfeld neben unserem Garten schlagen die Amerikaner ihr Camp auf.“ Sandra Paretti ist – nach einem privaten Briefwechsel mit dem Weidener Kulturamtsleiter – Ehrengast bei den 1. Weidener Literaturtagen im Mai 1985 (Thema: „1945 – Wie war das eigentlich?“), liest und erzählt am 4. Mai 1985 im großen (überfüllten) Sitzungssaal des Alten Rathauses.
Nach der Besetzung bzw. Befreiung der Max-Reger-Stadt funktioniert die US-Army sofort das Mannschaftsgefangenenlager der Wehrmacht STALAG XIII B nahe der (heutigen) Ostmark-Kaserne um in das US-Prisoner Camp „Einhorn“. Tausende von deutschen Soldaten der Wehrmacht, der Waffen-SS, des Deutschen Roten Kreuzes, der Wlassow-Armee beziehen dort ihr Quartier. „Hinter Stacheldraht lagen sie, Mann an Mann“ beginnt das Weiden-Kapitel des damaligen Kriegsgefangenen und späteren sächsischen Bestsellerautoren Erich Loest (1926-2013) in seinem autobiographischen Roman „Durch die Erde ein Riß“. Im Frühjahr 1945 agierte er in „den böhmischen Wäldern zwischen Schönsee und Eslarn“ als junger „Werwolf“, und in seinem Essay „Stille Rückkehr eines Werwolfs“ (enthalten in „Saison in Key West“, 1986) beginnt er: „Nach Weiden in der Oberpfalz mußte ich noch einmal, ich hab‘ es vierzig Jahre lang gewusst.“ Denn auch Loest zählt zu den Ehrengästen der 1. Weidener Literaturtage 1985.
Tausende Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus dem Baltikum, dem Warthegau, Schlesien und Pommern und dem Sudetenland treffen in Weiden ein. Als eine der größten Städte Nordostbayerns wird Weiden zu einem Sammelplatz. Weiden sieht in jener Zeit viele illustre Durchziehende, Heimatlose, Rückkehrer auf dem Wege nach Hause. Im Juni 1945 gelangt der (vom Judentum zum Protestantismus konvertierte) Professor für Romanistik Victor Klemperer (1881-1960) auf dem Rückweg von München nach Dresden in die Max-Reger-Stadt, später festgehalten in „Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933 – 1945“ (1995): „Wieder dauerte die Fahrt nicht lange: 6 km vor Weiden, mitten in der Landstraße. Erneutes Ausladen bei vielen Schimpfen. Wir wanderten zur Stadt hinein, ich ging wieder auf die Kommandantur, ich fand selbst mit Hilfe der Polizei, die mit einem Schluck Bier aushalf, keine Eß- und Trinkmöglichkeit, ich erhielt nach einer Stunde von der Kommandantur einen Zivilpolizisten, der uns wieder zu einem umlagerten und umschimpften Auto und dort hinaufschaffte. Wir fuhren am frühen Nachmittag weiter, durch hübsche Gebirgsgegend, aber müde und skeptisch, und erreichten das Nest Windischeschenbach ...“
Im Oktober 1945 stößt der junge schlesische Kriegsheimkehrer und spätere Kabarettist Dieter Hildebrandt (1927 – 2013) auf seine vor der Roten Armee aus Bunzlau/Niederschlesien geflüchtete Mutter, die in Windischeschenbach Zuflucht fand: „Ich tippte also auf Weiden in der Oberpfalz, erreichte die Stadt irgendwie, ging in die Flüchtlingskartei und fand die Bestätigung. Vater, Mutter und Bruder waren in einem Ort 17 Kilometer entfernt, in Windischeschenbach, gemeldet...“ (Biographie „Denkzettel“, 1992). In Weiden besucht Dieter Hildebrandt im Schuljahr 1946/47 die Klasse 8 b (Studienrat Dr. Hausschild) in der Oberrealschule (heute: Kepler-Gymnasium), arbeitet anschließend auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr und wird Kabarettist („Münchner Lach- und Schießgesellschaft“, „Scheibenwischer“). Immer wieder kommt Hildebrandt nach Weiden, als Schauspieler bei der Kleinen Bühne 1973, zur Autorenlesung 1997 in die Max-Reger-Halle oder zu den 23. Weidener Literaturtagen „Heimat“, wo er im überfüllten Postkellersaal am 11. Mai 2006 aus seinem Buch „Ausgebucht“ (2006) liest – mit rückblickenden Anekdoten auf Weiden und die Oberpfalz.
Mehrmals besucht der oberschlesische Schriftsteller Heinz Piontek (1926-2003) nach seiner US-Kriegsgefangenschaft in Waldmünchen Verwandte in Burggrub: „Ich nahm mir einen Tag Urlaub und nutzte das verlängerte Wochenende zu einer Bahnfahrt nach Weiden/Oberpfalz aus. Ab Weiden brauchte man eine Hundenase und mußte gut zu Fuß sein, wenn man zwischen endlosen Feldern und weitauseinanderliegenden Ortschaften auf dieses Dorf Burggrub stoßen wolle, wo die Familie Hentschke nach ihrer Flucht aus dem Osten ein Unterkommen gefunden hatte…“ („Stunde der Überlebenden. Autobiographischer Roman“, 1989).
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg kommt der oberfränkische sozialdemokratische Schriftsteller mit dem Pseudonym „Kurt Hölder“ („Die Frau ohne Mann“, Fortsetzungsroman 1929) und Journalist („Oberfränkische Volkszeitung“) Anton Döhler (1891-1988) über Konstanz, wo er nach NS-Schutzhaft in der Schuhbranche arbeiten musste, nach Weiden. Der berühmte US-Presseoffizier (ICD) Ernest Langendorf (1907-1989) bietet ihm die Lizenz zur Mitherausgabe einer Zeitung an, um die deutsche (demokratische) Presselandschaft Stück für Stück wieder herzustellen. Zusammen mit Victor von Gostomski, ebenfalls einem überzeugten NS-Gegner, schafft Anton Döhler als Verleger und Chefredakteur eine solide Grundlage für die heutige Nordoberpfälzer Tageszeitung „Der neue Tag“. Am 31. Mai 1946 kann „Der neue Tag“ als 19. Bayerische Lizenzzeitung endlich von der Bevölkerung Weidens und der Umgebung gelesen werden.
Wahrlich nach 12 (bis heute nachwirkenden) Jahren eines „Tausendjährigen Reiches“ hatte eine neue Zeit des Schrifttums, des Pressewesens auch in Weiden Einzug gehalten. Der Aufbruch war gelungen. Wohl kaum ein deutscher Klassiker könnte den menschlichen und baulichen Zusammenbruch, das totale Chaos und den Neubeginn einer Stadt, eines Landes, ihrer Menschen, besser in Worte fasse, als der bedeutende Dramatiker und Lyriker Friedrich Schiller (1759-1805), dessen Vorfahren mütterlicherseits aus der Oberpfälzer Bergstadt Erbendorf stammen – wenn er in seinem „Wilhelm Tell“ (1802/1804) darin im 4. Akt, 2. Szene den Bannerherrn „Werner, Freiherr von Attinghausen“ sprechen lässt: „Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,/ Und neues Leben blüht aus den Ruinen.“
Baron, Bernhard M., Weiden in der Literaturgeographie. Eine Literaturgeschichte [= Weidner Heimatkundliche Arbeiten Nr. 21], Weiden i.d.OPf. 1992, 4. Auflage 2007.
Bayer, Karl / Baron, Bernhard M., Eine Stadt wird braun. Sonderdruck des Medienhauses Spintler Druck und Verlag, Weiden i.d.OPf. 1993, 4. Auflage 2002.
Ostermann, Rainer, Kriegsende in der Oberpfalz. Ein historisches Tagebuch, Regenstauf 2015.
Stadtarchiv/-museum Weiden, NS-Gewalt-Herrschaft am Beispiel Weiden. Eine Dokumentation, Weiden i.d.OPf., 2020.
Vogelsang, German (Hg.), Sie kommen. Die letzten Kriegstage in der Oberpfalz 1945, Weiden i.d.OPf. 2005.


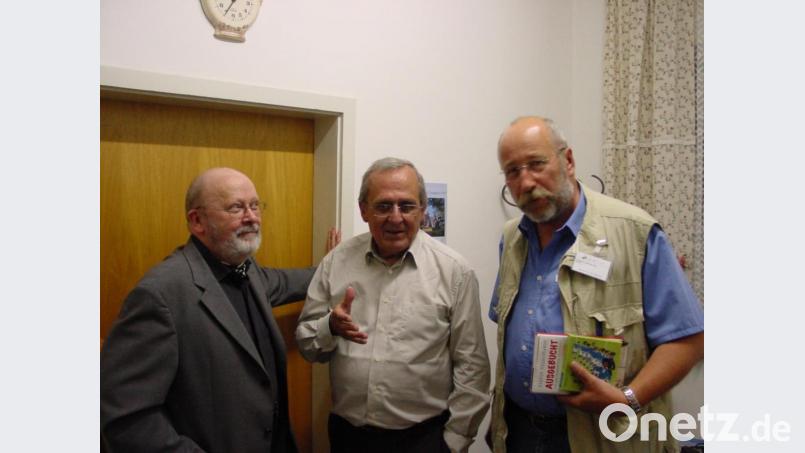
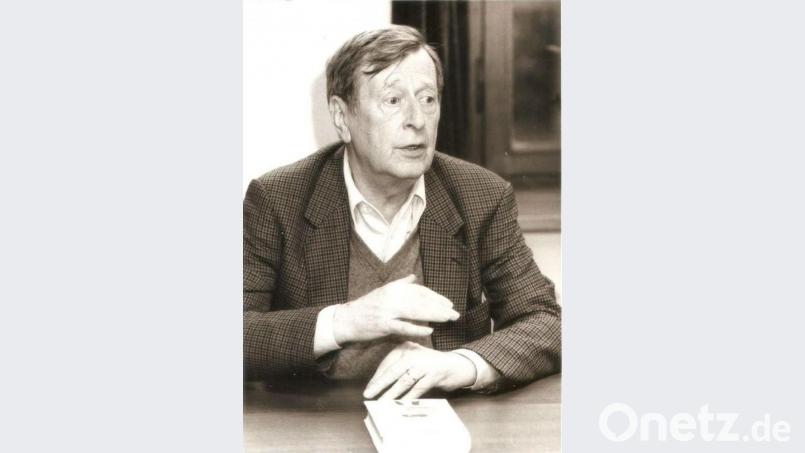

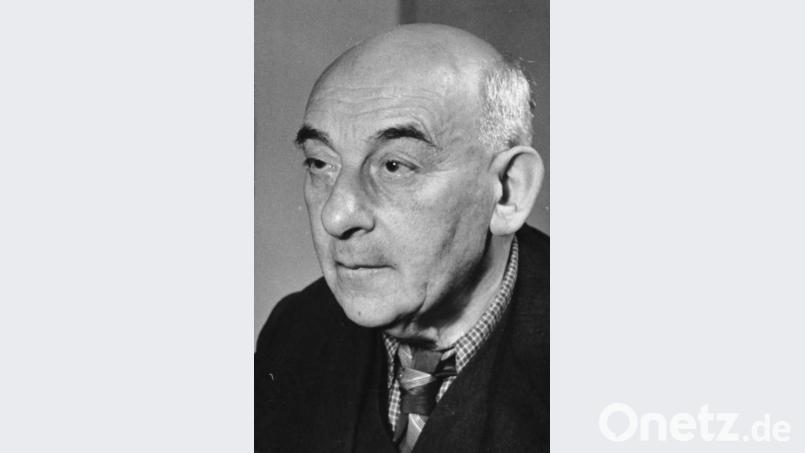
















Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.