Dass sich ein Angeklagter mit Bild in der Zeitung oder im Onetz wiederfindet, kommt jetzt nicht so häufig vor. Die Öffentlichkeit hat möglicherweise ein großes Interesse an seiner Identifizierung, der Betroffene natürlich nicht. Grundsätzlich lässt sich sagen: Ja, es ist in bestimmten Fällen erlaubt, Angeklagte mit Foto in den Medien zu bringen. Die Redaktion wird sich die Entscheidung gut überlegen und in den meisten Fällen das Gesicht unkenntlich machen (pixeln).
"Es geht um eine schwierige Abwägung zwischen der wichtigen Resozialisierung von Tätern, deren notwendiger Verurteilung und den Gefühlen der Opfer. Und es geht um das öffentliche Interesse an einer Identifizierung", hat Leseranwalts-Kollege Anton Sahlender in einer seiner vielen Kolumnen einmal verdeutlicht. Sahlender ist auch Vorsitzender der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), die sich auch mit Fragen des Presserechts beschäftigt. "Rechtens, so halte ich fest, sind die Kriminalberichte mit Namen und Bild von Tätern meistens. Notwendig sind Namen und Bilder aber nicht immer. Zuweilen bedarf es des ,Medienprangers' nicht", meint Sahlender.
Straftat muss schwer sein
Die Ziffer 8 des Pressekodex, die sich mit dem Schutz der Persönlichkeit befasst, besagt: "Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung. Ist aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse, so kann es in der Presse erörtert werden. Bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen; bloße Sensations-Interessen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Soweit eine Anonymisierung geboten ist, muss sie wirksam sein."
Für ein überwiegendes öffentliches Interesse spricht nach den Bestimmungen des Deutschen Presserats in der Regel, wenn
- eine außergewöhnlich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat vorliegt,
- ein Zusammenhang bzw. Widerspruch besteht zwischen Amt, Mandat, gesellschaftlicher Rolle oder Funktion einer Person und der ihr zur Last gelegten Tat,
- bei einer prominenten Person ein Zusammenhang besteht zwischen ihrer Stellung und der ihr zur Last gelegten Tat bzw. die ihr zur Last gelegte Tat im Widerspruch steht zu dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hat,
- eine schwere Tat in aller Öffentlichkeit geschehen ist,
- ein Fahndungsersuchen der Ermittlungsbehörden vorliegt.
Gibt es hingegen konkrete Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit des Verdächtigen oder Täters, soll auf eine identifizierende Berichterstattung verzichtet werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Wenn erneut über ein zurückliegendes Strafverfahren berichtet wird, sollen im Interesse der Resozialisierung in der Regel Namensnennung und Fotoveröffentlichung des Täters unterbleiben. "Das Resozialisierungsinteresse wiegt umso schwerer, je länger eine Verurteilung zurückliegt", betont der Presserat.
In Gerichtsberichten sind die Namen von Richtern, Staats- und Rechtsanwälten oder Sachverständigen meistens zu lesen. Über Personen, die an der Rechtspflege beteiligt sind, darf in der Regel identifizierend berichtet werden. Und zwar dann, wenn sie ihre Funktion ausüben.
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen: Straftaten gehören zum sogenannten Zeitgeschehen, und es ist die Aufgabe der Presse, über dieses zu schreiben. Anton Sahlender verweist in diesem Zusammenhang auf den Bundesgerichtshof, der festgestellt habe: Wer den Rechtsfrieden bricht, müsse das durch ihn selbst erregte öffentliche Interesse dulden. Insbesondere gelte das für aufsehenerregende Verbrechen, denn bei ihnen bestehe ein anzuerkennendes öffentliches Interesse an näherer Information über Tat und Täter.
Internet vergisst nicht
Wie sieht es in der Medienwelt mit der Resozialisierung aus? Dazu erläutert Sahlender: Gestört bleibe sie durch das Internet, "das nichts vergisst, selbst wenn ein Recht auf Vergessen gegen Suchmaschinen-Betreiber eingeklagt werden kann. So bleiben auch die meisten Namen und Bilder in den Kriminalberichten, die in den zugänglichen digitalen Archiven von Medien abrufbar vorliegen, von diesem Recht unberührt. Diese Freiheit wird den Medien als Chronisten des Zeitgeschehens eingeräumt. Wenn Redaktionen daraus doch wieder etwas löschen, dann geschieht das nach gut begründeten Anfragen meist freiwillig."
Ausschluss der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit eines ordentlichen Gerichtsverfahrens kann aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. „Dann ist auch der Gerichtsberichterstatter vor der Tür, da die freie Gerichtsberichterstattung nur für öffentliche Gerichtsverfahren gilt“, erläutern die Rechtsexperten der Initiative Tageszeitung (ITZ).
Grundsätzlich ausgeschlossen wird die Öffentlichkeit demnach
– bei ehrengerichtlichen Verfahren gegen Angehörige bestimmter Berufsstände,
– bei Disziplinarverfahren gegen Beamte und Soldaten, soweit diese nicht die Herstellung der Öffentlichkeit beantragen.
Im Interesse anderer Rechtsgüter, so die ITZ-Juristen, gelte der Grundsatz der Öffentlichkeit weiterhin nicht in Jugendstrafsachen und im überwiegenden Teil der Familiensachen.
Bei öffentlichen Gerichtsverfahren könne die Öffentlichkeit (und damit der Gerichtsberichterstatter) für die Verhandlung oder einen Teil ausgeschlossen werden. Das ist möglich
– zum Schutz von Persönlichkeitsrechten;
– bei Gefährdung der Staatssicherheit, der öffentlichen Ordnung, für Leib oder Leben des Angeklagten oder eines Zeugen, der Sittlichkeit,
– bei Gefährdung schutzbedürftiger Interessen wie Geschäfts-, Betriebs- oder Steuergeheimnissen.
Bei Ausschluss der Öffentlichkeit kann einzelnen Personen, also auch Vertretern der Medien, die Teilnahme an der Verhandlung gestattet werden kann. Soweit ein Berichterstatter anwesend sein darf, gilt für ihn: Er darf über die fraglichen Inhalte nicht berichten. „Das Gericht kann auch eine eingeschränkte Öffentlichkeit herstellen und hinsichtlich der darin erörterten Angelegenheiten ... zur Geheimhaltung verpflichten. Dieser Geheimhaltungspflicht gilt dann auch für Vertreter der Presse. Ihre Verletzung ist ... strafbar“, ergänzen die Rechtsexperten der ITZ. (kan)
Verdächtiger darf vor dem Urteil nicht als Schuldiger hingestellt werden
Laut Gerichtsverfassungsgesetz sind Verhandlungen vor den Gerichten einschließlich der Verkündung von Entscheidungen öffentlich. „Dies gilt nicht nur für die ordentliche Gerichtsbarkeit, sondern für alle sonstigen Gerichtsbarkeitszweige: für Zivilgerichte, aber auch für die Verwaltungs-, Arbeits-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit“, verdeutlichen die Juristen der Initiative Tageszeitung (ITZ) in ihrem Online-Lexikon. Das Recht auf Zutritt für die Medien sei daher nicht presserechtlich begründet, es leite sich aus dem allgemeinen Öffentlichkeitsprinzip ab.
Auf Folgendes weisen die ITZ-Rechtsexperten explizit hin: „Wahrheitsgetreue Berichte über Gerichtsverhandlungen bleiben von jeder Verantwortung für den Inhalt frei; diesen aus der Parlamentsberichterstattung übernommenen Grundsatz haben die meisten Länder in den Landespressegesetzen auf die Gerichtsberichterstattung ausgedehnt. Praktische Folge: ein Gegendarstellungsanspruch besteht nicht.“
Erinnert wird an die publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserates. Sie fordern:
– die Berichterstattung über Ermittlungs- und Gerichtsverfahren soll frei von Vorurteilen erfolgen.
– Vor Beginn und während der Dauer eines Verfahrens müssen die Medien jede einseitige, tendenziöse oder präjudizierende Stellungnahme vermeiden und zwischen bloßem Verdacht und erwiesener Schuld streng unterscheiden.
– Ein Verdächtiger darf vor einem gerichtlichen Urteil nicht als Schuldiger hingestellt werden.
Zur Namensnennung sowie Abbildung und Darstellung eines Prozessbeteiligten: Sie „berühren den Schutzbereich des Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Bei der aktuellen Berichterstattung über Gerichtsverfahren dürfte das Informationsinteresse der Öffentlichkeit grundsätzlich Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz der Betroffenen haben. Jedoch ist auch hier neben der Rücksicht auf den unantastbaren Innersten Lebensbereich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Danach ist eine Namensnennung, Abbildung oder sonstige Identifikation nicht immer zulässig. Die Veröffentlichung eines Fotos des Verdächtigen in der Presse ist nur bei schwerwiegenden Straftaten zulässig. Wo bei Straftätern der Gedanke der Resozialisierung im Vordergrund steht, geht das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen in aller Regel vor ... Dem allgemeinen Informationsbedürfnis der Bürger kann ... auch ohne Namensnennung entsprochen werden.“
Der gleiche Schutz steht den Opfern spektakulärer Verbrechen zu. Die ohnehin zum Beispiel für das Opfer einer Vergewaltigung schweren Folgen dürften durch eine Berichterstattung nicht noch verstärkt werden. „So ist nicht gerechtfertigt, das Sensationsbedürfnis der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung von Fotografien zu befriedigen“, mahnen die ITZ-Juristen. Ein Foto des Opfers verletze dessen Persönlichkeitsrecht.
Strafbar macht sich, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Schriftstücke ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut veröffentlicht, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. „Ausdrücklich ist nur die wortgetreue Wiedergabe, also das wörtliche Zitat, unter Strafe gestellt – sinngemäßes Zitieren ist kein Problem“, erläutern die ITZ-Juristen. Wo genau der Sinn dafür liegt, der Beschuldigte vor einer Bloßstellung schützen soll, ist für sie jedoch nicht ganz einfach nachzuvollziehen: „Ein Bericht über den sachlichen Inhalt der Anklageschrift ohne Zitat dürfte für den Beschuldigten normalerweise nicht weniger bloßstellend sein als wörtliche Zitate.“ (kan)
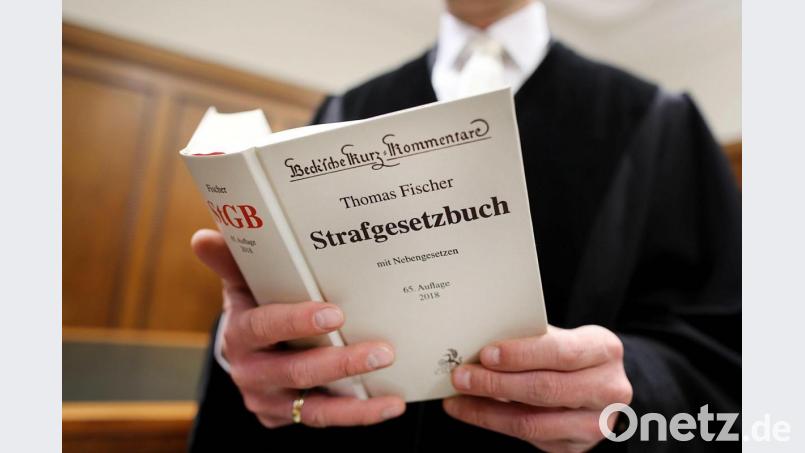
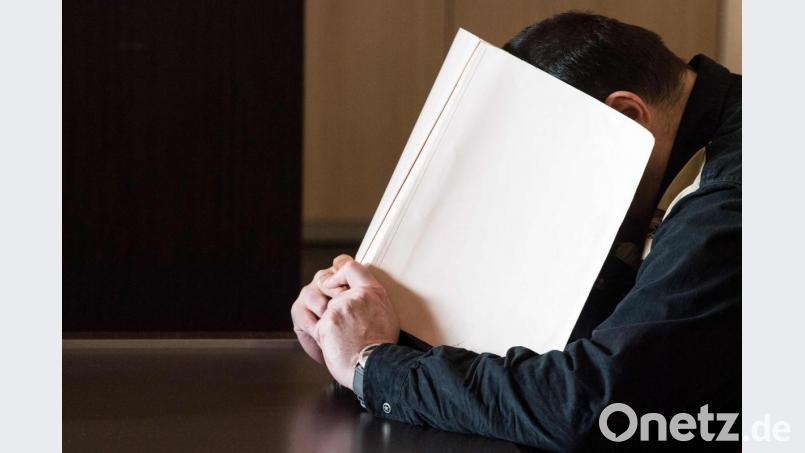













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.