Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Krankenhäuser fast ausschließlich unter Arbeitsablauf- und Zweckmäßigkeitsaspekten gebaut und eingerichtet. Technische Fragen standen im Vordergrund. In den vergangenen Jahren wird jedoch das Krankenhaus zunehmend aus dem Blickwinkel der Patienten gesehen. „Entscheidend ist, was ist für die Patienten das Beste, danach muss sich Architektur und Einrichtung ausrichten“ sagt Professor Clemens Bulitta, Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieure an der OTH in Weiden.
Um darüber neue Erkenntnisse zu gewinnen und internationale Erfahrungen auszutauschen, organisierte Bulitta jetzt zum sechsten Mal den internationalen Kongress „Hospital Engineering Trends“. Knapp 100 Teilnehmer aus über zehn Ländern hörten zwei Tage lang Vorträge über moderne Krankenhausgestaltung und sprachen in Workshops und Podiumsdiskussionen darüber.
Ausgangslage ist: Mehr als die Hälfte der Patienten in Krankenhäuser sind älter als 65 Jahre. 30 Prozent davon haben demenzbedingte Einschränkungen ihrer Wahrnehmung. Vor allem an den körperlichen und mentalen Eigenschaften älterer Menschen müssen sich Baulichkeiten, Einrichtung und Infrastruktur eines Krankenhauses ausrichten.
Zahlreiche Referenten des Kongresses befassten sich mit diesem Themenkomplex. Beispielsweise Birgit Dietz vom Bayrischen Institut für demenzsensible Architektur für Gesundheitsimmobilien. Unter anderem stellte sie die Frage: Erreichen Rollstuhlfahrer im Sitzen auch alle Schalter und Bedienungselemente? Eine andere Frage lautete: Sehen und begreifen ältere Menschen alle Symbole und Wegweiser im Krankenhaus? Verhindert werden muss, dass das Krankenhauspersonal viel Zeit damit verbringen muss, umherirrende Patienten wieder zurück in ihre Zimmer zu bringen. Die Farbgestaltung der Räume und der Einrichtung spielt laut Referentin eine sehr große Rolle. Farben können Barrieren bilden, Orientierung bieten und ein Wohlfühlgefühl auslösen.
Ähnliches gilt für das Licht. Es schafft Sichtbarkeit, Emotionalität und hat gesundheitliches Auswirkungen. Das Thema Licht im Krankenhaus wurde im Vortrag Referat von Markus Prinz vom Universitätsklinikum Erlangen vertieft. Lichtsysteme spielen vor allem eine große Rolle im Kampf gegen die vor allem in Intensivstationen häufig auftretenden Delir-Zustände bei Patienten. Delir ist ein Verwirrtheitszustand, der bei 50 bis 80 Prozent der Intensivpatienten auftreten würde. Das Sterblichkeitsrisiko innerhalb von sechs Monaten würde sich bei Delir-Fällen verdreifachen. Neben der Lärmbekämpfung und möglichst vielen Angehörigenkontakten kann Delir-Zuständen mit speziellen Beleuchtungssystemen und Farben entgegengewirkt werden.
Oft seien es aber auch nur ganz einfache Dinge, wie freie Sicht in die Natur, die helfen könnten. Wichtig ist es, immer den Tag-Nacht-Rhythmus herzustellen, damit Melatonin-, Serotonin- und Cortisolbildung im Körper ausgelöst wird. Dass ein möglichst enger Zusammenhang zwischen der Patientenumgebung und den therapeutischen Konzepten hergestellt werden muss, erläuterte Andreas Faltlhauser von den Kliniken Nordoberpfalz. Ärzte und Architekten müssten eine gemeinsame Sprache finden, fordert er.
Absolut unbestritten war bei allen Experten, dass die Krankenhausumgebung großen Einfluss auf Heilungsprozesse und Verweildauer hat. Das Themenspektrum des Kongresses war sehr breit. Es reichte von der Einrichtung von Patientenbädern und Patiententransportsystemen bis hin zu internationalen Entwicklungsprojekten im Krankenhauswesen. OTH-Vizepräsident Professor Ulrich Müller begrüßte die Gäste.













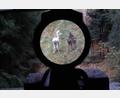

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.