Warum lassen sich immer mehr Menschen von extremistischem Gedankengut anziehen? Eine Frage, die auch der Bundesinnenminister nicht beantworten kann - auch wenn man von ihm dazu zumindest eine Theorie erwarten darf. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts stellt Horst Seehofer die Frage in den Raum, ob es einen Zusammenhang zwischen einer "bestimmten Politik" und der Radikalisierung der Bevölkerung gebe. Konkreter: Ob die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge die Deutschen in den Rechtsextremismus treibe.
Ganz davon abgesehen, dass man seine Äußerungen als weiteren Seitenhieb gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin verstehen könnte: Wenn die Zahl der in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge seit 2015 immer weiter sinkt, die Zahl der Rechtsextremen und Neonazis 2017 aber gestiegen ist, lautet die Antwort: nein. Fakten spielen jedoch ohnehin kaum eine Rolle für Menschen, die irgendeiner Form von Extremismus verfallen - das gilt auch für die Linksradikalen und sowieso für Islamisten, die sich an eine perverse Version ihrer Religion klammern.
Wir leben in Zeiten, in denen die Grautöne verschwinden - es gibt scheinbar nur noch Schwarz und Weiß. Politik kann Extremismus kaum verhindern. Aber sie kann immer wieder deutlich machen: Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Und sie darf sich die Rhetorik derer nicht zu eigen machen, die das extreme Gegenteil behaupten.



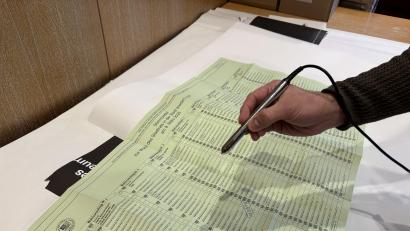










Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.