Der Kreis der Unehrenhaften war von Stadt zu Stadt und - abhängig von der Zeitstellung - recht unterschiedlich. Zum "harten Kern" gehörten stets der Scharfrichter, der "Wasenmeister" (auch Schinder oder Abdecker genannt) und der "Frauenwirt", also der Betreiber des Freudenhauses beziehungsweise des "Frauenhauses" nach mittelalterlichem Sprachgebrauch.
In Amberg und sicher auch in anderen Städten hatte der Henker bei Dienstantritt einen Eid zu schwören. Dieser beinhaltete im Wesentlichen das Versprechen der Gehorsamkeit gegenüber dem Rat der Stadt, der Verschwiegenheit und eines sittsamen Lebenswandels. Dabei gab vor allem der Lebenswandel oft Anlass zur Klage.
Henker-Dynastien
Der in den Büchern festgehaltene Eid erlaubt uns, die Henker-Dynastien über Jahrhunderte zurückzuverfolgen. In kurpfälzischer Zeit war der Amberger Henker für die gesamte Oberpfalz zuständig. Er reiste mit seinem Gesellen zum Hinrichtungsort. Lieber holte man jedoch den Todeskandidaten nach Amberg zur Hinrichtung, denn diese war ein Schauspiel und ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Sie diente auch der Abschreckung, weshalb möglichst viele Schaulustige teilnehmen sollten. Ergänzend sei gesagt, dass die Stadt Amberg, obwohl hier der Henker über 500 Jahre beheimatet war, nie die Hohe Gerichtsbarkeit innehatte. Diese lag beim Landesherrn. Doch die hohen Herren machten sich nicht gerne die Finger schmutzig und delegierten an die Stadt. So musste der Henker zwei Herren dienen, was für ihn oft ein Ärgernis war.
Das "kleine" Freudenberg, bis 1594 eigener Herrschaftsbereich, hatte zum Beispiel die Hohe Gerichtsbarkeit, also das Blutgericht, inne. Dort gibt es heute noch die Flurbezeichnung Galgenberg. Wäre jemand hingerichtet worden, hätte man den Amberger Henker damit beauftragt. Im Sinne der Amberger wurden den Delinquenten jedoch lieber nach Amberg zur Hinrichtung geholt. Der Galgen allein sollte für jeden, der Böses im Schilde führte schon abschreckende Wirkung haben.
Sieben Mal zugeschlagen
Das Schwert des Amberger Henkers ruht seit 1864. Damals fand in München die letzte Hinrichtung mit dem Schwert statt. Doch dort gab es keinen Henker mehr. So lieh man sich den Amberger Henker aus. Wie peinlich: Dieser musste sieben Mal zuschlagen, bis der Kopf rollte. Im Mittelalter wäre bei so viel Pfusch der Henker selbst auf dem Schafott gelandet.
Bayern stieg aufs Fallbeil um. Dieses war in napoleonischer Zeit in Frankreich erfunden worden. Die Hinrichtung mit dem Schwert ging den Revolutionären nicht schnell genug. In Bayern war das Fallbeil, ursprünglich Guillotine genannt, bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Gebrauch.
Ohne Bürgerrechte
Was hieß nun "unehrenhaft"? Der mit diesem Makel Bedachte konnte keinen Grund und somit kein Haus erwerben. Er war von öffentlichen Ämtern, von bestimmten Gottesdiensten und Sakramenten ausgeschlossen und musste sich durch besondere Kleidung zu erkennen geben. Das Bürgerrecht war ihm versagt. Jeder Kontakt mit ihm war verpönt, man wäre selbst in die Unehrenhaftigkeit hineingerutscht. Er wohnte in der hierarchisch gegliederten Stadt am Rand, an der Stadtmauer.
Das "Handwerk" blieb in der Familie. Nach dem Tod des Henkers übernahm sein Sohn oder sein Schwiegersohn, sofern seine Tochter einen ebenfalls unehrenhaft geborenen Partner fand, das Gewerbe.
In Bayern wissen wir von einem einzigen Henker, der die Ehrenhaftigkeit zurück erlangte: Franz Schmidt in Nürnberg, 1634. Sein Vater war mangels eines Henkers vor Ort in Hof in das Handwerk hineingezwungen worden. Sein Sohn Franz wurde sein Nachfolger. Dieser leistete vor allem in Nürnberg so gute Arbeit, dass man ihn nach seiner Pensionierung, auch wegen des dem Vater auferzwungenen Handwerks, in die Ehrenhaftigkeit entließ. Sein Schicksal spiegelt sich im Henkerhaus-Museum, dem früheren Dienstsitz des Henkers, in Nürnberg wider.
Häufig, doch nie in der Oberpfalz, war der Henker in Personalunion auch "Wasenmeister" und vor Errichtung der "Frauenhäuser" im 13. Jahrhundert auch "Vorgesetzter" der Prostituierten. In der Oberpfalz war der Amberger Henker mit Hinrichtungen, um 1700 etwa 100 im Jahr, und mit den Strafen am Pranger und an der Breche hinreichend ausgelastet.
Wo war eigentlich der Galgenberg in Amberg? Nun, der älteste ist zumindest dem Namen nach das Henkerbergl, ursprünglich vor der ersten Stadtmauer gelegen, heute Teil der Stadtbefestigung. Wir wissen jedoch nicht, ob dort jemals gerichtet wurde. Dokumentiert sind die Hinrichtungen am Galgenberg am Ende des gleichnamigen Weges. Den Galgen dort findet man erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts auf der Zeichnung von Hans Ludwig Kandlpaldung.
Außerdem weiß man noch von einem dritten Galgen auf halbem Weg zwischen Ziegeltor und Mariahilfberg. Der Chronist Anton Dollacker schreibt, dass dieser im 17. Jahrhundert verlegt werden musste, da den Gläubigen nicht zuzumuten war, auf dem Weg zum Gnadenbild an den Gehängten vorbei zu pilgern. (ddö)


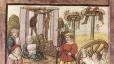
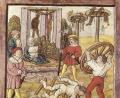













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.