(tu) Wenn möglich, bediente man sich auch hier der Wasserkraft, wie aus der Stadtchronik von Heimatforscher Siegfried Poblotzki (1917 - 1997) hervorgeht. Sebastian Troßner, der von 1854 bis 1870 erst als Kooperator und später als Pfarrprovisor in Pleystein wirkte, berichtete 1868 in seinem Tagebuch über die Modernisierung in seinem Pfarrgebiet. Demnach verbesserte der Besitzer der Pingermühle seine Schneidsäge dadurch, dass er ein eisernes Getriebe einsetzen ließ, was die starke Reibung verminderte.
1867 stellte er zusammen mit dem Schlossermeister Balthasar Wüst aus Pleystein unter dem Sägegebäude eine Eisendreherei auf, in der Stücke mit einem Durchmesser bis zu 15 Zoll gefertigt werden konnten. Diese Dreherei war ein unabweisbares Bedürfnis geworden, weil die Schleif- und Polierwerke zweckmäßiger eingerichtet werden konnten und auch die Reparaturen einer größeren Präzision bedurften, die durch Handarbeit nicht erreicht werden konnte.
Blech statt Bretter
Die Familie Haberstumpf von Peugenhammer schaffte sich im Herbst 1867 eine Dreschmaschine an, die Herr von Sperl in Gröbenstädt fertigte und in Peugenhammer aufstellte. An dieselbe wurde zugleich eine von Schreinermeister Josef Frank produzierte Putzmühle angebracht, mit der das Getreide gereinigt wurde. Frank hatte zu den Bögen Blech statt Bretter verwendet. Sie ließen sich viel zweckmäßiger biegen.
Damals bestanden im Pfarrbezirk folgende Maschinen: in der Kreis-Wiesenbauschule Pfrentsch Dreschmaschine, Schrotmaschine, Branntweinbrennapparat; in Finkenhammer Dreschmaschine, Häckselmaschine sowie eine Wurzelschneidemaschine; auf der Pingermühle eine Eisendreherei. All diese Geräte wurden mit Wasserkraft betrieben. Mit Handbetrieb arbeiteten beim "Kreuzwirt" Lehner und in Bruckhof eine Handdreschmaschine, bei Peter Bergler in Spielhof sowie bei Johann Eckert in Lohma eine Häckselmaschine und beim Hafner Michael Wilhelm in Pleystein eine Tonquetschmaschine.
Nicht lang in Betrieb
Rotgerber Michael Piehler, Hausnummer 85, beantragte 1885 die Genehmigung zur Aufstellung eines Dampfkessels von vier PS zum Betrieb einer Lohstampfe. Die Pläne zeichnete Maurermeister Weig. Der Maschinenraum sollte an die Steingasse angrenzen. Piehler kaufte 1885 eine gebrauchte Lokomobile und stellte sie ohne Genehmigung auf. Sie hatte sich wohl nicht bewährt, denn als das Königliche Bezirksamt im Januar 1886 wegen der zu erfüllenden Bauauflagen anfragte, erklärte Piehler, dass er die Dampfmaschine außer Betrieb gesetzt habe und sie wieder verkaufen werde.
Michael Wildenauer stellte 1907 eine Hochdruck-Lokomobile zum Betrieb seines Spatwerkes in Hagendorf auf. Der Dampfkessel von der Firma Lanz, Mannschein, war auf einen Druck von zehn atü ausgelegt. Der Sägewerksbesitzer Johann Lang präsentierte 1919 eine Dampflokomobile für seinen Betrieb. Sie wurde von der Firma Badenia, Weinheim, geliefert. Sie hatte einen Kessel für 10 atü und eine Leistung von 62 PS. Der Kamin war 25 Meter hoch.

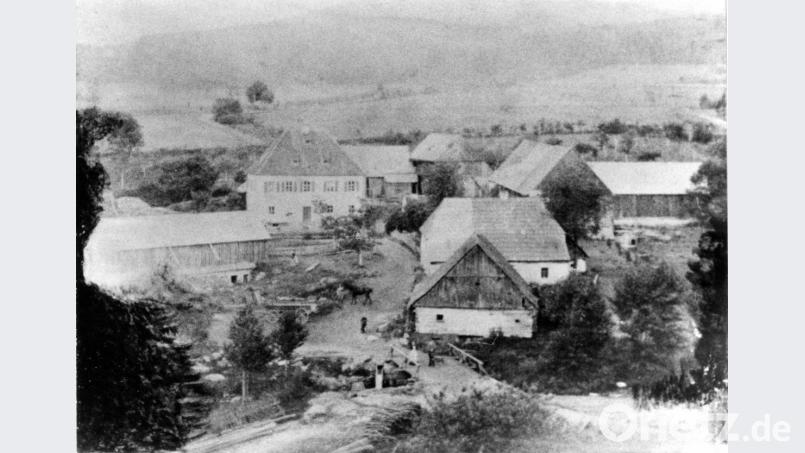
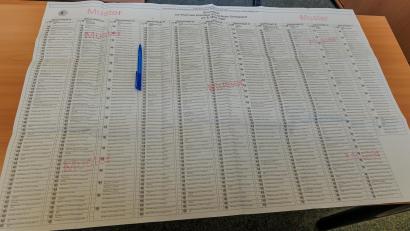












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.