Die Initiatoren für das Biomasse-Heizkraftwerk scheiterten auf der Zielgeraden. Es fehlten nur noch 200 Kilowatt Anschlusszusage zur prognostizierten Wirtschaftlichkeit. In einer öffentlichen Stadtratssitzung am 9. April 1996 hatte Diplom-Ingenieur Wolfgang Reis ein Grobkonzept zur Nahwärmeversorgung in Schönsee skizziert. Dieses gab den entscheidenden Antrieb für die Initiative von Stadt, Wald- und Hausbesitzern. Bei denkbaren Standorten bei der Schule, nahe der Kläranlage oder an der Eslarner Straße sollten damals große Wärmeverbraucher, wie Hotels, Pensionen und Firmen, die Schule, etwa 20 Häuser in der Innenstadt sowie ein neu geplantes Baugebiet angeschlossen werden.
Dem Stadtrat war klar, dass die Zeit drängte: Der Innerortsausbau der Staatsstraße (Hauptstraße) war ein Jahr später terminiert. Vorgesehen war, die Verlegung der Nahwärmeleitungen in der Innenstadt parallel mit dem Straßen- und Gehwegbau zu koordinieren. Zwei Monate später warteten in einer öffentlichen Sitzung am 11. Juni Ingenieur Wolfgang Reis und ein OBAG/Bayernwerk-Vertreter mit ersten konkreten Förder-Zusagen auf. Die OBAG beteiligt sich an den Kosten der Machbarkeitsstudie mit 60 Prozent, stellt für den Bau einen Investitionszuschuss von 20 Prozent in Aussicht und der Staat fördert die Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks mit Nahwärmenetz bis maximal 48 Prozent.
Der Stadtrat beschloss einstimmig, dem Ingenieurbüro Reis den Auftrag für eine rund 17 000 Mark teure Machbarkeitsstudie zu erteilen, „um die erforderliche Entscheidungsgrundlage für die Realisierung eines Biomasseheizkraftwerks in Schönsee zu erhalten.“ Zwischen April 1996 und April 1997 kam das Projekt in sieben öffentlichen Sitzungen zur Sprache. Dies unterstreicht, welch große Bedeutung die Stadt dieser Thematik beimaß. Der Beschluss in der Novembersitzung 1996, Schule und Rathaus anzuschließen, war ein wichtiges Signal für die geplante Betriebsgesellschaft.
Am 20. November 1996 gründeten 22 Gesellschafter, darunter die Stadt Schönsee, die „Biomasseheizwerk Schönsee GdbR". Auf keinen Fall wollten sie ein Geschäfts- und Wirtschaftlichkeitsrisiko eingehen, aber dafür alles versuchen, dieses Pilotprojekt für die Region zu realisieren. Man war sich einig, nur dann grünes Licht für die je nach Bedarf der Wärmekunden zwischen zwei und fünf Millionen Mark veranschlagte Investition zu geben, wenn ausreichendes Eigenkapital gezeichnet und genügend Hausbesitzer Abnahmeverträge abschließen. Als Standort für die Anlage sollte möglichst eine Fläche im Besitz der Stadt gefunden werden.
Aus Fördergründen und wegen des bevorstehenden Straßenausbaus setzten sich die Beteiligten den April 1997 als Entscheidungsmonat. Einen Monat davor, mit einem am 5. März 1997 datierten Rundschreiben, richtete die Initiative den fast flehentlichen Appell an unentschiedene Hausbesitzer, sich für den Anschluss zu entscheiden, um die noch für die Wirtschaftlichkeit einer abgespeckten Lösung fehlende etwa 200 Kilowatt Anschlussleistung unter Dach und Fach zu bringen. Als Argumente für einen Anschluss wurden genannt: Umweltfreundliche Wärmeerzeugung aus einheimischen Wäldern mit genügend Schwach- und Schadholz, das zu Hackschnitzeln verarbeitet werden kann, Kostenersparnis und Raumgewinn für entfallenden Heizungs- und Öltankraum und die Zusage, einen Kachel- oder Kaminofen weiterschüren zu dürfen.
Kurz vor Torschluss aktualisierte das Ingenieurbüro Ende März 1997 erneut das Konzept mit den bis dahin geschlossenen Abnahmeverträgen und nannte neue Zahlen. Mit einer Minimalversion reduzierten sich die Investitionskosten auf 1,95 Millionen Mark, außerdem war eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschafter auf 350 000 Mark vorgesehen. Als Standort der Anlage war nun – statt an der Eslarner Straße – die Fläche zwischen Schulbusparkplatz und Grundschulgebäude vorgesehen. Hackschnitzelbunker und die neue Biomasse-Heizanlage hätten in den Hang hineingebaut werden sollen. Ein direkter Zugang von dort zu den Heizräumen der Schule wurde ins Visier genommen.
Doch die letzten eindringlichen Appelle verhallten leider ungehört. Und so blieb dem Gesellschafterkreis nichts anderes übrig, als der Öffentlichkeit im April 1997 mitzuteilen, dass die intensiven Bemühungen leider nicht zum Erfolg führten. „Wenn man die Geschichte mit einem Bergsteiger vergleicht, dann mussten wir nur wenige Meter vor dem Erreichen des Gipfels umkehren und aufgeben", hieß es in der Erklärung. Bildhafte drückte dies die tiefe Enttäuschung aus. Doch einen Absatz weiter gingen die Gedanken schon wieder in die Zukunft: „Die Gesellschafter sind inzwischen mehr denn je überzeugt von der Richtigkeit einer Wärmeerzeugung mit einheimischer Biomasse, vielleicht lässt sich später ein Projekt in Schönsee oder Umgebung auf anderer Grundlage verwirklichen.“













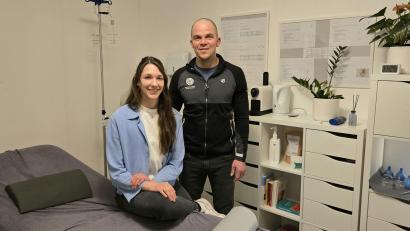


Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.