Georg Mayer, der Leiter des AELF Schwandorf, hieß die Teilnehmer der Videokonferenz zum neuen Pflanzenbautag willkommen. Gleich danach kam die erste Referentin Roswitha Walter, Leiterin der Arbeitsgruppe "Bodentiere" am Institut Agrarökologie an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, zum Thema "Die Bedeutung der Regenwürmer für die Bodenfruchtbarkeit - wie kann der Landwirt sie fördern" zu Wort.
In Deutschland gibt es laut Pressemitteilung des Amts eine große Vielfalt an Regenwürmern, die sich auf verschiedene Bodenschichten spezialisiert haben und durch ihre vielfältigen Leistungen die Bodenfruchtbarkeit fördern. Der bekannteste Vertreter ist wohl der "Große Tauwurm", der zu den tiefgrabenden Arten zählt und dessen Röhren bis in mehrere Meter Tiefe reichen können. Zur Nahrungsaufnahme zieht er große Mengen an Stroh in seine Röhren, wodurch die organische Substanz gut in den Boden eingemischt wird. Durch die Grabtätigkeit lockern und belüften die unterirdischen Mitarbeiter den Boden und brechen verschlämmte Krusten auf. Sie bilden strukturprägende Röhren, die das Wurzelwachstum positiv beeinflussen, aber zum Beispiel auch das Eindringen von Niederschlägen in den Boden fördern und somit den Oberflächenabfluss und die Bodenerosion mindern können.
"Ein guter und vielfältiger Regenwurmbestand im Acker weist auf einen gesunden, biologisch aktiven Boden hin und prägt so die unter- und oberirdische Biodiversität in Agrarökosystemen", so Walter. Doch wie kann der Landwirt die Regenwürmer fördern? Die Maßnahmen zur Förderung des Regenwurmbestands auf Ackerflächen sind vielfältig: wichtige Bausteine sind dabei eine möglichst vielfältige Fruchtfolge, die Zufuhr von organischer Substanz, wie Gülle, Stallmist oder auch das Belassen von Ernterückständen auf der Fläche und der Anbau von Zwischenfrüchten. Auch eine bodenschonende Bewirtschaftung, bei der Bodenverdichtungen vermieden werden und die Intensität der Bearbeitung, beispielsweise durch einen Verzicht auf den Pflug reduziert wird, wirkt sich positiv auf die Bodentiere aus.
Innovativ sein und bleiben
Die zahlreichen Versuchsergebnisse, die Roswitha Walter vorstellte, stießen auf großes Interesse bei den Landwirten, was sich an der anschließenden regen Diskussion zeigte, die von Patricia Steinbauer, Pflanzenbauberaterin am AELF Schwandorf geleitet wurde. Neben den Ergebnissen aus der Forschung sind aber gerade die Erfahrungen aus der Praxis in der Landwirtschaft von großer Bedeutung.
Michael Reber, ein Landwirt aus Schwäbisch-Hall, bewirtschaftet seinen Betrieb unter dem Motto "Innovative Landwirtschaft - aus Verantwortung für die Zukunft" und gestaltete mit seinem Vortrag den zweiten Teil des Abends. Er bewirtschaftet zusammen mit seiner Familie seit 2006 einen Betrieb, der sich mittlerweile stark verändert hat. Aus dem klassischen hohenlohischen Schweinebetrieb wurde über die Jahre ein Ackerbaubetrieb mit fünfgliedriger Fruchtfolge und Biogasanlage. Mittlerweile hat der Hof mehrere Standbeine, unter anderem auch eine kleine Direktvermarktung für eigenen Bio-Apfelsaft von den umliegenden Streuobstwiesen und eigenes Schweinefleisch. Als Substrat für die Biogasanlage dienen Gülle, Mist, Grassilage, Ganzpflanzensilage, Maissilage und auch die Durchwachsene Silphie. Auch Reber hatte in der Vergangenheit mit einer Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen, wie er berichtet: zunehmende Witterungsextreme, stagnierende Erträge bei zunehmenden Aufwand, steigende Pachtpreise, zunehmende Restriktionen wie durch die Düngeverordnung und pflanzenbauliche Probleme durch Resistenzen sowie das schlechte Image der Landwirtschaft in der Bevölkerung, was ihn dazu bewogen hat, sein Augenmerk mehr auf den Boden zu legen.
Nach einem Bodenkurs bei Dietmar Näser und Friedrich Wenz versucht er nun Humus aufzubauen und gleichzeitig mineralischen Dünger einzusparen und chemische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Ziel dabei ist es durch z. B. möglichst vielfältige Bodenbedeckung die natürliche Bodenfruchtbarkeit zu fördern und zu steigern. "Viele Landwirte sind zu technikgläubig und vergessen die Biologie", so Reber.
Pflanzen an Gewässern erhalten
Den Abschluss des Abends machte Reinhard Baumer vom AELF Schwandorf, der aktuelle Hinweise zur Mehrfachantragstellung gab und das Thema "Gewässerrandstreifen" ansprach. So ist unter anderem zu beachten, dass neben dem Bayerischen Naturschutzgesetz nun auch das Wasserhaushaltsgesetz einen Gewässerrandstreifen vorschreibt. Es greift bei landwirtschaftlich genutzten Flächen mit einer durchschnittlichen Hangneigung über fünf Prozent in den ersten 20 Meter ab Böschungsoberkante und schreibt zum Schutz des Gewässers in den ersten fünf Metern eine geschlossene Pflanzendecke vor, die es zu erhalten gilt. Auch sollten noch nicht erfasste Randstreifen digitalisiert werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass für jeden Antragsteller ein persönlicher Besprechungstermin reserviert ist.













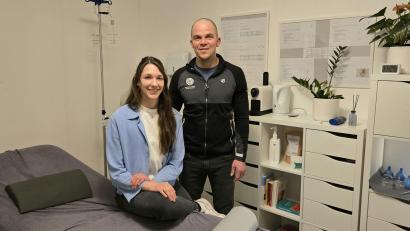








Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.