Parkstein. 14 Tage vorher, am 21. August 1968, sind Panzer der Roten Armee in Prag eingerollt. Der "Prager Frühling" ist eine bittere Enttäuschung. Jeder Reformgedanke in den Reihen der Kommunisten hat sich mit dem Einmarsch der russischen Armee erledigt. Die Idee von einem "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" wird gewaltsam niedergeschlagen. "Es war eine utopische Idee, dass sich der Kommunismus reformieren könnte", sagt Marie Krása.
"Uns war klar: Wenn wir jetzt nicht gehen, dann ist für 20 Jahre Schluss. Dann ist der Eiserne Vorhang dicht", erinnert sich Zdenek Krása. Der Chirurg und die Chemikerin gehören beide nicht der kommunistischen Partei an. "Wir gingen nicht konform mit diesem Regime." Sein Studium erfolgte unter erschwerten Bedingungen. Um den Kindern ein Leben in Freiheit zu ermöglichen, fällen sie eine folgenschwere Entscheidung.
Baby als "Pfand"
Sie wollen eine Reisegenehmigung nutzen - für eine Reise ohne Wiederkehr. Die Krásas haben dieses Papier einer glücklichen Fügung zu verdanken: Zdenek hat in der Lungenklinik Ausig eine Sudetendeutsche behandelt. Geheilt von Tuberkulose siedelt die Frau nach Regensburg über. Zum Dank schreibt sie eine Einladung. Auf deren Basis dürfen die Krásas bereits im Juli 1968 für vier Tage nach Deutschland reisen. Marketa lassen sie bei den Großeltern zurück. Die einjährige Tochter ist auch auf der erneuten Reiseerlaubnis nicht vermerkt. Marie Krása lässt sie in letzter Minute nachtragen. "Die haben mir das ohne ein Wort genehmigt."
Am 4. September 1968 rollt der vollgepackte Renault Fregate an den Übergang Ceská Kubice/Furth im Wald. An Bord: Zdenek und seine schwangere Frau Marie, hinten die Kinder Martin und Marketa. Sogar ein Schlauchboot ist im Kofferraum verstaut, um den Schein zu waren. Ihre Hochschuldiplome haben die Krásas in der Reserveradmulde versteckt. Bis zum letzten Meter ist nicht klar, ob die Grenze noch passiert werden kann. Auch hier stehen russische Panzer. Ein tschechoslowakischer Offizier kontrolliert unter den Augen eines russischen Soldaten - die Kalaschnikow im Arm - das Auto. Er lässt Motorhaube und Kofferraum öffnen. Außer der Familie sind keine Reisenden vor Ort. "Wir waren ganz alleine da."
Elf Tage später im Dienst
Uns war klar: Wenn wir jetzt nicht gehen, dann ist für 20 Jahre Schluss.
"Keine Angst", habe der tschechische Offizier gesagt, "ich muss das machen, weil er mich beobachtet." Er lässt die Hauben schließen und gibt das Zeichen zur Weiterfahrt. Marie und Zdenek Krása haben den Eindruck: "Die Stimmung in der ganzen Bevölkerung richtete sich gegen diese Invasion. Die Besatzung durch die Russen war ein Schock für das ganze Land." Militärs eingeschlossen.
In Bayern fährt die Familie direkt zur Wohnung der Patientin in Regensburg und klingelt. Sie sagt: "Was macht ihr denn hier?" Die Krásas antworten: "Wir sind gerade geflüchtet." Schon am zweiten Tag steht das Paar im Arbeitsamt. Die Chemikerin wird wieder weggeschickt: "Man sagte mir: Wenn ihr Mann Arzt ist, brauchen Sie hier nicht zu arbeiten." Zdenek Krása bekommt eine Stelle in der Klinik Passau-Kohlbruck.
Am 15. September 1968 trägt er schon wieder den weißen Arztkittel. Elf Tage nach der Flucht. Er wechselt nach Donaustauf und schließlich ab Februar 1969 in die Lungenklinik Wöllershof. In Donaustauf wohnt die Familie auf der Station zwischen Patienten. In Wöllershof ziehen die Krásas ins Ärztehaus auf dem Gelände. Marek kommt zur Welt, 1974 David. 1975 baut die Familie in Parkstein.
Der Wechsel nach Wöllershof erfolgt auch deshalb, weil das Anerkennungsverfahren für den Thoraxchirurgen fürchterlich kompliziert ist. Die Approbation bekommt er ohnehin erst mit der deutschen Staatsbürgerschaft 1980. Seine Karriere beschließt Krása als Leitender Oberarzt am Bezirksklinikum Wöllershof. Nach Auflösung der Lungenklinik ist er noch bis zum Eintritt in den Ruhestand 1999 Leiter der Thorax-Chirurgie im Klinikum in Marktredwitz.
Alles gut gelaufen? Das Opfer war groß. Am 4. September 1968 sind Zdenek und Marie Krása noch über Prag gefahren, um sich von ihren Eltern zu verabschieden. "Sie wussten nicht, ob und wann sie uns wiedersehen." Ihren insgesamt fünf Geschwistern sagen sie nichts, um niemanden zu gefährden. Und tatsächlich vergeht geraume Zeit, bis man einander wiedersieht. Im Oktober 1969 haben die Eltern schon eine Ausreisegenehmigung. Als der Vater die Fahrkarten bis Schirnding kaufen will, klärt man ihn auf, dass sämtliche Erlaubnispapiere für ungültig erklärt wurden. "Am Fahrkartenschalter hat man ihm gesagt: Alles ist zu." Besuche erfolgen sporadisch, mit großem Aufwand.
Treffen in Maribor
In Abwesenheit werden Marie und Zdenek wegen Republikflucht zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Mit ihren Geschwistern treffen sie sich ganz konspirativ am Plattensee und im damaligen Jugoslawien. In Maribor wird ein Treff vereinbart, dann fahren die vier, fünf Familien weiter ans Meer. Drei Wochen verbringen die Geschwister und ihre Kinder miteinander. Nur die jüngste Schwester von Marie Krása hat nur den Mann dabei: Für die Kinder hat sie keine Genehmigung bekommen. Sie ist es auch, die erst 1988 erstmals zur Schwester nach Deutschland darf.
"Unsere Kinder kannten ihre Verwandten fast nur von Bildern", bedauert Marie Krása. Sohn David bemerkt als kleiner Bub, dass bei all seinen Freunden in Parkstein zum Geburtstag oder zur Erstkommunion alle Cousinen und Cousins kämen: "Bei uns kommt niemand." Das ist durch den Fall des Eisernen Vorhangs und die Gründung eigener Familien inzwischen "kompensiert". Zdenek und Marie Krása haben 13 Enkel. Martin ist HNO-Arzt in Nürnberg und hat zwei Kinder. Marketa hat Sprachen studiert und fünf Kinder aufgezogen. Marek ist Urologe in Bamberg mit vier Kindern. Geophysiker David lebt mit seiner Familie (zwei Kinder) in Brüssel.
Tödliche Grenze
Bei Familienfeiern wird regelmäßig die Buchung einer ganzen Pension nötig. Zuletzt traf man sich in Rybnik, dem tschechischen Ort gegenüber Schönsee/Stadlern. Es wurde der 80. Geburtstag von Marie Krása gefeiert. Die Großeltern zeigten den Enkeln bei der Gelegenheit, wo der Eiserne Vorhang verlief. Die tödlichste Grenze Europas. Ein systematisch aufgebauter, mehrere Kilometer breiter Grenzstreifen mit Elektrozaun, Sperranlagen, Hundezwingern. Zdenek Krása hat die Sperrzone selbst gesehen: Er war 1953 einer Arbeitsbrigade zum Heu machen zugeteilt.
Er hat sich gefreut, als die Weidener Staatsanwaltschaft 2017 Ermittlungen zu den Todesfällen am Eisernen Vorhang aufgenommen hat. Die Kommunistische Partei habe sich bis heute nicht angemessen distanziert. Einer der Beschuldigten, Ex-Generalsekretär Milos Jakes, sei erst jetzt wieder taufrisch im Fernsehen aufgetreten. Tschechien feiert 2018 ein doppeltes Jubiläum: 100 Jahre Gründung der Tschechoslowakischen Republik, 50 Jahre "Prager Frühling".
Die kommunistische Diktatur hat das Familienleben der Krásas über Jahrzehnte überschattet. "Die nach 1989 Geborenen wissen nicht mehr, wie das war." Der Wert der Europäischen Union könne nicht hoch genug geschätzt werden. Die Annäherung an Diktatoren, zuletzt durch Trump an Nordkorea, hält er für einen Fehler. Ihm gefällt auch nicht, dass sich die Visegrád-Staaten in der Flüchtlingsfrage nicht solidarisch erklären. Der 84-Jährige trocken: "Gott sei Dank sind wir damals nicht nach Tschechien geflüchtet."

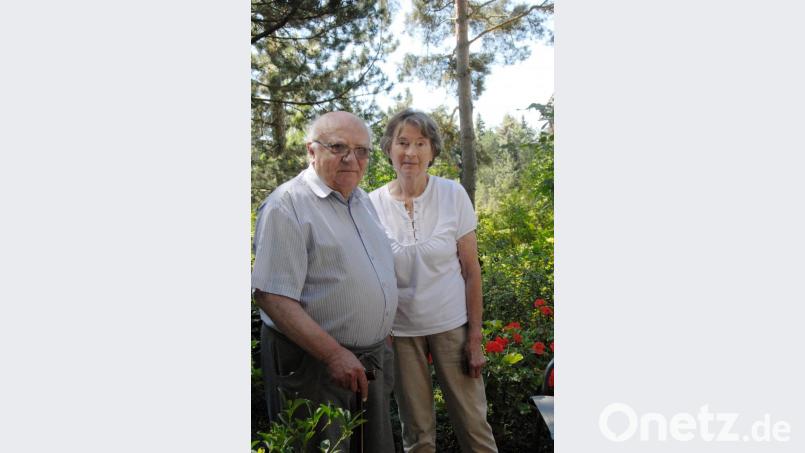














Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.