ONETZ: In dieser Woche beginnt im Vatikan der Anti-Missbrauchsgipfel. Welche Signale erwarten Sie? Welche Signale müssen kommen?
Thomas Schärtl-Trendel: Thomas Schärtl-Trendel: Papst Franziskus appelliert vehement an die Verantwortung der Bischöfe, insbesondere an deren Verantwortung für die Opfer. Das ist ein ungeheuer wichtiger Schritt. In den letzten Tagen wurden auch dramatische Missbrauchsfallzahlen bei den Southern Baptists in den USA bekannt. Da es dort keine so starken Strukturen und erst recht keinen Papst gibt, ist dort die Aufarbeitung weitaus schwieriger. Der Petrusdienst des Papstes ist unter diesen Vorzeichen für uns ein Segen. Ein wichtiges Signal wird sein müssen, dass die transparente Aufarbeitung der Fälle und die Fürsorge für die „Survivors“ oberste Priorität bekommt. Auch die unter Benedikt XVI. schon begonnen Verschärfung des kirchlichen Strafrechts muss weitergeführt werden. Ein Priester, der das Beichtgeheimnis bricht, ist exkommuniziert. Ein Priester, der sich an einem Kind oder einem Untergebenen vergeht, wurde – etwas überspitzt gesagt – „ernsthaft ermahnt“. Der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke sagte zu Recht, dass man diese Diskrepanz keinem Außenstehenden mehr vermitteln kann.
ONETZ: In Deutschland prüfen Staatsanwälte hunderte Fälle von Priestern, denen Missbrauch zur Last gelegt wird. Die Missbrauchsstudie legt nahe, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist.
Thomas Schärtl-Trendel: Schon die im letzten Herbst veröffentlichte MHG-Studie sprach bei den bekannt gewordenen Fallzahlen von einer „unteren Schätzgröße“. Dieser Ausdruck ist eine brennende Wunde; die Reputation des Amtes in der Kirche ist schwer beschädigt. Nicht nur die Priester, insbesondere die Bischöfe sind in eine der schwersten Vertrauenskrisen geraten. Man legt ihnen Vertuschungskartelle, Verschweigen und die Diskreditierung der Opfer zur Last. Für eine Institution, die auf die Glaubwürdigkeit ihrer Autoritäten setzen muss, ist das eine Katastrophe.
ONETZ: Wie kann diese Vertrauenskrise überwunden werden?
Thomas Schärtl-Trendel: Der Weg führt nur über radikale Aufklärung und Transparenz – auch und gerade um der vielen guten und treuen Priester willen. Prävention allein (so wichtig sie ist) wird den „Survivors“ nicht gerecht. Ich habe daher an anderer Stelle für die Einrichtung einer Wahrheitskommission oder einer Art kirchlicher Gauck-Behörde votiert. Solange nur der Hauch des Verdachts im Raum stehen bliebe, dass nicht alle Bistümer in gleicher Weise an der radikalen Aufklärung interessiert sind, stürzt die Glaubwürdigkeit der Kirche noch weiter ins Bodenlose.
ONETZ: Die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche ist zur Machtfrage geworden. Konservative schieben die Schuld am Missbrauch auf Reformen oder auf Homosexuelle. Ist nicht der Klerikalismus, der Absolutheitsanspruch, der sich mit dem Priester- und Bischofsamt verbindet, das grundlegende Problem?
Thomas Schärtl-Trendel: An den USA lässt sich beobachten, wie sich die kirchenpolitischen Flügel zerfleischen. Ich hoffe, dass das in Deutschland nicht so weit kommt. Es ist auch die Verantwortung der Bischöfe, hier den Laden buchstäblich zusammenzuhalten und das Ohr nicht nur traditionalistischen Echokammern mit ihrer einseitigen revisionistischen Geschichtsklitterung zuzuwenden, die alle Schuld der Modernisierung der Kirche seit dem letzten Konzil zuschieben möchten. Nein, Missbrauch gab es (leider) auch schon vor dem Konzil. Vor wenigen Tagen wurde der Fall des 1967 verstorbenen, stramm konservativen New Yorker Kardinals Francis Spellman neu in die Öffentlichkeit gespült, der nicht nur eine Affäre mit einem Broadway-Tänzer gehabt haben soll, sondern auch Seminaristen und Kadetten sexuell belästigt und ausgebeutet hat.
ONETZ: Ein Fall, den Konservative nicht werden hören wollen ...
Thomas Schärtl-Trendel: Die Problemanalyse muss jenseits aller Verschwörungstheorien nüchtern und ehrlich erfolgen: Wer den Pennsylvania Grand Jury-Report oder die MHG-Studie konsultiert, wird neben (einigen) Fällen krankhaften sexuellen Begehrens (Pädophilie) oft dem Problem einer unreifen oder unterdrückten Sexualität begegnen. Homosexualität per se zu inkriminieren ist ungefähr genauso sinnvoll, wie im Fall von Harvey Weinstein (mit dem die #Me-Too-Debatte in Hollywood ins Rollen kam), Heterosexualität per se zum Sündenbock zu machen.
Thomas Schärtl-Trendel, geb. 1969, stammt aus Tännesberg (Kreis Neustadt/WN). Er ist Zögling des Bischöflichen Studienseminars in Weiden und besuchte gleichzeitig das Augustinus-Gymnasium. Seit dem Jahr 2015 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Philosophische Grundfragen der Theologie an der Universität Regensburg. Er studierte in Regensburg und München; promovierte in Tübingen und habilitierte sich an der Hochschule für Philosophie in München. Von 2006 bis 2009 war der Oberpfälzer Assistant Professsor of Systematic Theology an der Catholic University in Washington DC. Von 2009 bis 2015 lehrte er als Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg, ehe er nach Regensburg wechselte.
ONETZ: Viele Kritiker stellen nun den Pflichtzöllibat infrage.
Thomas Schärtl-Trendel: In die konkreten, durchaus komplexen Missbrauchsursachen – auch den Pflichtzölibat kann man nicht einfach so für alles verantwortlich machen – mischt sich natürlich das strukturelle Problem: Schweige- und Vertuschungskartelle, ein aktives Wegsehen etc., ein Ignorieren der Opferperspektive. Papst Franziskus hat dafür das Stichwort „Klerikalismus“ aufgegriffen und damit nicht zu Unrecht eine Club- oder Kastenmentalität angeprangert. Es gibt aber auch Expertenstimmen, die nahe legen, dass ein überzogenes Priesterbild und eine Überidentifikation mit der Kirche zu jenen eigenartigen Dissoziierungen beigetragen haben, die wir bei Tätern und auch bei den die Täter deckenden Bischöfen beobachten mussten. Ohne solche Dissoziierungen wäre nicht zu erklären, wie Männer mit pastoraler Verantwortung das Wohl von Kindern, Jugendlichen und Abhängigen so eklatant ignorieren konnten.
ONETZ: Bischöfe und Papst haben ja in Glaubensfragen das letzte Wort? Lässt sich das angesichts der Verwicklung selbst von Kardinälen und Bischöfen aufrechterhalten?
Thomas Schärtl-Trendel: Einige meiner Kollegen verweisen zu Recht darauf, dass eine Institution, die moralische Autorität reklamiert, gerade dann, wenn sie in einem ungeahnten Maße in eben diesem Anspruch versagt, buchstäblich in ein Schwarzes Loch stürzt. Der Vergleich mit anderen Institutionen die versagt haben (Turn- und Sportvereine, Internate) hilft der Kirche nicht, weil sie sich theologisch immer als eine Realität begriffen hat, die eine menschliche und eben auch göttliche Seite besitzt. Die Missbrauchstäter, Vergewaltiger und sexuellen Ausbeuter Abhängiger – und ich möchte das so drastisch sagen – haben Christus ein weiteres Mal ans Kreuz geschlagen; und sie werden sich nicht nur vor irdischen Richtern dafür verantworten müssen.
ONETZ: Wo bleiben dabei die Opfer?
Thomas Schärtl-Trendel: Die Kirche muss aber den „Survivors“ wie dem Gekreuzigten begegnen: in einem nicht nur geschäftsmäßigen und juristischen Maß von Begegnung, pastoraler Fürsorge und betroffener, schamhafter Ehrfurcht. Gleichzeitig braucht es – gerade um Vertrauen zurückzugewinnen – eine innerkirchliche Schamkultur. Die katholische Kirche hat eine hohe Ritualkompetenz; es dürfte gerade für sie nicht unmöglich sein, eine echte, ehrliche und nachhaltige Schamkultur zu entwickeln, die sich dauerhaft bewusst ist, dass das Antlitz Christi auch und gerade in den Gesichtern der „Suvivors“ zu finden ist. Papst und Bischöfe müssen auf dem Weg zu einer Schamkultur vorausgehen und sich buchstäblich auf einen Kreuzweg machen.
ONETZ: Ein Epizentrum des neuerlichen Missbrauchsbebens in den USA ist mit dem Namen Theodore McCarrick verbunden, den Sie persönlich kennen. Was bedeutet das für Sie? Lässt Sie das an der Institution Kirche zweifeln?
Thomas Schärtl-Trendel: Trotz der Krise versuche ich zäh an meinem Glauben festzuhalten. Als Schüler im Weidener Knabenseminar habe ich die Kirche als gastfreundliche, warmherzige, selbstlose Einrichtung kennengelernt – mit väterlichen, reifen, fürsorglichen und intellektuell ungemein wachen Priestern, die uns gefördert und mit großer Geduld begleitet haben. Dieses positiv besetzte Bild von Kirche kann man mir nicht austreiben. Trotzdem ist der Fall McCarrick für mich manchmal regelrecht zum Verzweifeln. Ich war von 2006 bis 2009 Professor in Washington DC an der dortigen Catholic University. McCarrick war sozusagen mein erster Bischof. Er galt als Star: charismatisch, eloquent, einfühlsam, vernetzt. McCarrick gibt dem Vertrauensproblem ein konkretes Gesicht, er steht für die Dissoziierung zwischen der Überidentifikation mit dem Amt einerseits und einem unfassbaren menschlichen Abgrund andererseits. McCarrick ist auch ein Symbol dafür, dass Kirchenleitungen auf warnende Stimmen von Priestern und Laien nicht gehört haben. An diesem Fall lässt sich jene Selbstabschottung und Selbstüberheblichkeit der Mächtigen beobachten, vor der schon ein Gregor der Große seine Priester und Bischöfe gewarnt hat.
ONETZ: Sehen Sie in der Gewaltenteilung eine mögliche Antwort?
Thomas Schärtl-Trendel: Veränderungen der Strukturen sind vielleicht nicht das Erste, wenn es um die Würde der „Survivors“ geht und darum, dass sie endlich Gerechtigkeit erfahren dürfen. Aber ohne eine strukturelle Veränderung ist gerade dieses primäre Ziel nicht zu erreichen und eine dauerhafte Kursänderung nicht sicherzustellen. Das Jahr 2018 hat anders als die vorhergehenden Missbrauchskrisen gezeigt, dass Macht kontrolliert werden muss, damit sie sich nicht abkapselt und schlussendlich ungerecht, willkürlich, zynisch oder sogar zerstörerisch wirkt. Im modernen Staatswesen ist Gewaltenteilung das wirksamste Instrument einer solchen Macht-Kontrolle.
ONETZ: Wie wäre so eine Machtkontrolle in der Kirche vorstellbar?
Thomas Schärtl-Trendel: Wie das in der katholischen Kirche konkret auszubuchstabieren ist bedarf weiteren theologischen Nachdenkens. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die konkrete Verfassungsgestalt der Kirche nicht vom Himmel gefallen, sondern historisch gewachsen ist – mit einer Rechtskultur, die einstmals zivilisatorisch wirkte, auch wenn manches darin jetzt aus der Zeit gefallen scheint. Dass es einen Petrusdienst, eine bischöflichen und priesterlichen Dienst in der Kirche gibt, lässt sich vom Evangelium her unterstreichen und befürworten; wie diese Dienste in einer konkreten Situation auszugestalten und zu realisieren sind, wie sich die Macht der Vollmächtigen ausdrückt, das müssen wir jeweils von den Zeichen der Zeit her neu bedenken und lernen. Und auch das Grässliche ist ein Zeichen, das wir zu deuten haben und das uns zu Revisionen anhält. Ich sehe da auch die Theologie – und darin auch mich – in der Verantwortung.





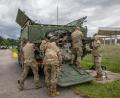









Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.