Im März beginnt die Hopfensaison. War der Hopfengarten neu angelegt oder war der alte gerodet worden, mussten Furchen gezogen werden. Mit dem Hopfenstichel, einer Stange mit einer eisernen Spitze, schlug der Bauer leicht schräg zulaufende Löcher. In diese kam die etwa sieben bis acht Meter lange Hopfenstange, leicht schräg wegen des geringeren Wind-Widerstandes. Vor die Stange, in das Pflanzloch, setzte der Bauer den mit Pferdemist gedüngten Hopfenfechser. Fechser konnten aus Wurzeln der Hopfenpflanze oder aus Trieben gewonnen werden. Schon bald folgte der erste Arbeitsschnitt, da zu viele Triebe das Wachstum beeinträchtigen. Die verbleibenden Triebe, meist drei, wurden im Uhrzeigersinn um die Hopfenstange gewickelt. Die Pflanze wuchs nun bis zu 30 Zentimeter am Tag. Im Juni begannen sich die Dolden zu bilden. Bis dahin musste der Bauer oftmals durch den Hopfengarten gehen, zurückschneiden oder auch - meist durch Wind - ineinander verschlungene Triebe, oft mehrerer Pflanzen entwirren.
Doch in Wirklichkeit war alles noch viel arbeitsaufwendiger: Unkraut musste gejätet, die jungen Triebe vor Wildverbiss geschützt werden. Bei dem schnellen Wachstum war feuchter Boden wichtig, auf Hopfenschädlinge galt es zu achten und schließlich war, um eine unerwünschte Befruchtung der Dolden zu vermeiden, männlicher Hopfen fernzuhalten.
Ende August, Anfang September war Hopfenernte. Die Hopfenranke wurde über dem Boden abgeschnitten, die Stange mit der Ranke mit einem hebelähnlichen Werkzeug gezogen und die Ranke von der Stange abgenommen. Nun galt es, die Dolden von der Ranke zu zupfen. Viele fleißige Hände waren notwendig. Bei nassem Wetter fuhr man die Ranken auf den Hof und zupfte, meist am Tisch, in die Tischschublade.
Die Dolden kamen nun zum Trocknen auf den dunklen (um die Bleichung der Dolden zu vermeiden) Dachboden, wurden dort ausgebreitet und - um den Prozess zu beschleunigen - mehrmals gewendet. Die hohen Giebeldächer, heute noch vielerorts zu sehen, sind auf diese Trockenböden zurückzuführen.
Nach dem Trocknungsprozess füllte der Bauer die Dolden in den Hopfensack, den Ballen, der etwa einen Zentner fasste. Da die Dolden dabei verdichtet werden mussten, war in den Fußboden des Trockenbodens meist eine Presse eingelassen. Der in die Presse eingespannte Hopfensack wurde gefüllt und die Dolden mit dem Stempel der Presse verdichtet.
Der Brauer verlangte Qualitätshopfen. Die Qualität und abgefüllte Menge belegte das Hopfensiegel, für das der verbeamtete Hopfenmesser verantwortlich zeigte. Siegelbezirke wurden geschaffen. Für den Hopfen aus dem Amberg-Sulzbacher Land war dies meist Hersbruck oder Hohenstadt. Nun konnte der Hopfen an den Brauer oder Händler abgegeben werden.



















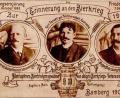



















Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.